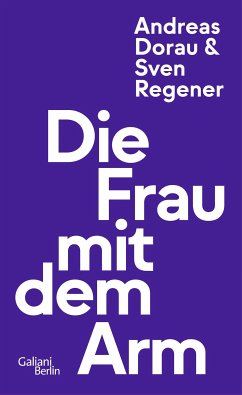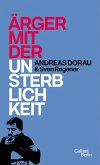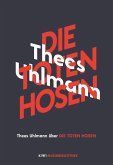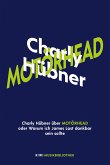„Mein Name ist Andreas Dorau. Durch einen Welthit wurde dieser Name bekannt. Das nützt aber nichts. Am Ende trifft man doch nur Leute, denen der Name nichts sagt.“ – ja, ich gestehe, damit meint er mich. Ich kannte ihn und seinen ersten großen Hit „Fred vom Jupiter“ nicht, denn als er den
veröffentlicht hat, war ich erst fünf Jahre alt. Trotzdem hat mich das Buch „Die Frau mit dem Arm“, das Dorau…mehr„Mein Name ist Andreas Dorau. Durch einen Welthit wurde dieser Name bekannt. Das nützt aber nichts. Am Ende trifft man doch nur Leute, denen der Name nichts sagt.“ – ja, ich gestehe, damit meint er mich. Ich kannte ihn und seinen ersten großen Hit „Fred vom Jupiter“ nicht, denn als er den veröffentlicht hat, war ich erst fünf Jahre alt. Trotzdem hat mich das Buch „Die Frau mit dem Arm“, das Dorau zusammen mit Sven Regener geschrieben hat, sehr interessiert. Vermutlich, weil der Titel so skurril klingt oder wegen Sven Regener, dessen Arbeit ich sehr schätze. Aber alles in allem lässt das Buch mich zwiegespalten zurück. Völlig Banales reiht sich an Uninteressantes, ab und zu unterbrochen von ein paar Abschnitten, die so charmant, poetisch und interessant waren, dass man nicht direkt querlesen wollte. Es war nicht mein Buch. Punkt.
Aber trotzdem von vorn.
Andreas Dorau befand sich zu Anfang des neuen Jahrtausends in einer Schaffenskrise und musste sich irgendwie neu erfinden. Und natürlich brauchte er, wie wohl die meisten von uns, Geld. Zusammen mit Sven Regener von Element of Crime schrieb er schon den ersten Teil seiner Biografie „Ärger mit der Unsterblichkeit“. Also, Sven Regener schrieb, Andreas Dorau war wegen seiner Legasthenie, der im Buch zwei Kapitel gewidmet sind, der Kopf dahinter. Berührend fand ich, die er über den Tod der Mutter 2007 erzählt. „Das traf mich sehr, mehr, als es mich viele Jahre zuvor getroffen hatte, dass mein Vater starb. Als Muttersöhnchen hatte ich mit meiner Mutter ein viel engeres Verhältnis als mit meinem Vater, ich hatte sie in der letzten Zeit auch gepflegt und ihr Tod und das damit verbundene Vollwaisensein warfen mich um. […] Das Leben wurde kalt, ich konnte keine Mutter mehr anrufen und nach diesem und jenem fragen und von diesem und jenem erzählen, alle Leichtigkeit und Verantwortungslosigkeit war aus den Dingen des Lebens verschwunden, weil es niemanden mehr gab, der mir so selbstverständlich helfen würde.“ Amüsant fand ich die Schilderung seiner Reise nach Moskau, eingeladen vom Goethe-Institut, die Erfahrungen beim Drehen von Videos und szenischer Umsetzung seiner Werke und seine Marotte, dass er wegen der Zeitschriften im Wartezimmer gern zum Arzt geht. Auch seine durch die Legasthenie bedingten Schwierigkeiten beim Einlesen von Theodor W. Adornos „Traumprotokolle“ fand ich interessant zu lesen und brachten mir den Künstler näher. Der Rest des Buchs las sich für mich aber ein bisschen plan- und konzeptlos, ohne richtigen roten Faden, mit sehr vielen Namen, die Kennern der Szene vielleicht geläufiger sind als mir. An diesen Stellen fand ich überhaupt keinen Zugang zu dem Buch.
Sprachlich und inhaltlich fand ich es also ebenso schwierig wie die Musik von Andreas Dorau, die ich zum besseren Verständnis des Buchs erst einmal im Internet angehört habe. Ich war und bin kein Fan und werde sicher nie einer werden. Nicht von seiner Musik und vermutlich auch nicht von seinen durchaus kreativen Ideen. Dennoch empfehle ich das Buch jedem Fan des Künstlers und jedem Kind der Neuen Deutschen Welle. Irgendwie erinnerte mich der manchmal etwas konfus wirkende Aufbau des Buchs, das Dinge zum Teil scheinbar wahllos aneinanderreiht, an „Wenn es dunkel und kalt wird in Berlin“ von Element of Crime. Zufall? Vermutlich nicht, denn auch das stammt aus der Feder von Sven Regener und da schließt sich für mich der Kreis. Ich vergebe vier Sterne, denn es ist kein schlechtes Buch, es war nur nicht das richtige für mich.