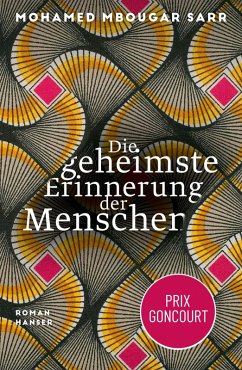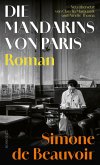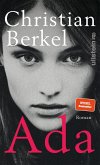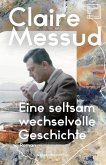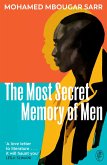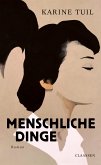Ausgezeichnet mit dem Prix Goncourt - Mohamed Mbougar Sarrs großer Roman über die Suche nach einem verschollenen Autor Mohamed Mbougar Sarr erzählt virtuos von der Suche nach einem verschollenen Autor: Als dem jungen Senegalesen Diégane ein verloren geglaubtes Kultbuch in die Hände fällt, stürzt er sich auf die Spur des rätselhaften Verfassers T.C. Elimane. Dieser wurde in den dreißiger Jahren als "schwarzer Rimbaud" gefeiert, nach rassistischen Anfeindungen und einem Skandal tauchte er jedoch unter. Wer war er? Voll Suchtpotenzial und unnachahmlicher Ironie erzählt Sarr von einer labyrinthischen Reise, die drei Kontinente umspannt. Ein meisterhafter Bildungsroman, eine radikal aktuelle Auseinandersetzung mit dem komplexen Erbe des Kolonialismus und eine soghafte Kriminalgeschichte. Ein Buch, das viel wagt - und triumphiert.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D, L ausgeliefert werden.
"Ein grandios inszeniertes literarisches Detektivspiel, das uns mit brandaktuellen Fragen nach Rassismus, Identitätspolitik und kultureller Aneignung konfrontiert." Denis Scheck, ARD druckfrisch, 27.02.23 "Ein fabelhaft, dicht geschriebener, fruchtbarer, in sich sehr angenehm verschachtelter, aber auch komplex konstruierter Roman." Samira El Ouassil, SWR lesenswert Quartett, 22.02.23 "Ein Meisterwerk. ... Ein sprachliches Ereignis." Denis Scheck, SWR lesenswert Quartett, 22.02.23 "Ein intellektuelles Vergnügen." Ijoma Mangold, SWR lesenswert Quartett, 22.02.23 "Ein gewaltiges, aufrüttelndes Buch: emotional, persönlich, zugleich absolut auf der Höhe des postkolonialen Diskurses." Dina Netz, WDR3, 11.02.23 "Ich habe Mohamed Mbougar Sarrs 'Die geheimste Erinnerung der Menschen' gelesen. Ein großartiges Buch." Bundeskanzler Olaf Scholz, taz, 14.01.23 "Was mir so gefällt ist, dass Sarr das mit so viel Engagement macht. Dass er sagt, die Literatur muss eigentlich die wichtigste Sache der Welt sein. Das ist für ihn eine existentielle Frage, ob er zu seiner literarischen Stimme findet. So viel Emphase auf die Literatur, auch auf die Wiederverzauberung, auf die Poesie." Iris Radisch, 3sat Kulturzeit, 11.01.23 "'Die geheimste Erinnerung der Menschen' ist makellos. Wie die Lösung des Krimis um Elimane trotz aller Sprünge zwischen Zeiten, Orten und Erzählsituationen chronologisch abrollt, zieht mit." Michael Wurmitzer, Der Standard, 03.01.23 "Eine atemberaubende Spurensuche ...Ein Puzzle starker Stimmen... Ein komplexer, wissenspraller und mitreißender Roman." Christoph Vormweg, Deutschlandfunk, 25.12.22 "So klug und so spannend - und diese wunderschönen Sätze! Man könnte sich in jeden einzelnen Satz des Romans verlieben, so perfekt und doch so urmenschlich sind sie." Sarah Murrenhoff, rbb Kultur, 19.12.22 "Einfach nur brillant!" Gert Scobel , 3sat Buchzeit, 11.12.22 "Ein Ereignis ist dieses Buch." Katrin Schumacher, 3sat Buchzeit, 11.12.22 "In Sarrs begnadeten Händen gerät die Literatur zu einem zutiefst menschlichen Labyrinth, das vielleicht keinen Ausgang, aber dafür auch fast keine Irrgänge kennt. Dank der herausragenden Übersetzung von Sabine Müller und Holger Fock hat man nun die einmalige Chance, sich auch auf Deutsch einen eigenen, einmaligen Weg durch dieses Labyrinth zu bahnen." Samir Sellami, ZEIT Online, 11.12.22 "Sarr ist ein literarisches Genie. Mit diesem Roman hat er sich den literarischen Kanon nicht nur zu eigen gemacht, sondern sich darin eingeschrieben." Thomas Hummitzsch, Der Freitag 09.12.22 "Ein fulminanter Wurf. ... Dieser Roman ist ein Geschenk; wer sich auf ihn einlassen mag, wird reich belohnt: mit einem Füllhorn an packenden Geschichten und einer Vielzahl an (Denk-)Welten, die sich immer wieder neu auftun bei der staunenden Lektüre." Ulrich Noller, WDR 5 Bücher, 09.12.22 "Es geht um den senegalesischen Autoren eines "perfekten Buchs" und einen zweiten, der ihm folgt. Literatur, Kolonialismus und die Folgen, erzählt als Detektivgeschichte. Das perfekte Buch? Womöglich hält man es in den Händen." Stern, 08.12.22 "In einer kraftvoll-schillernden Prosa erzählt Sarr eine kunstvoll verflochtene Geschichte von der Literatur und ihren Gefahren, von schwarzen Autoren und weissen Kritikern, von Heimat und Exil, von der Last der Vergangenheit und den Abgründen der Gegenwart. ... Berauschend ist dieser Roman, reichhaltig und tiefgründig und in seiner Vielfalt oft so rätselhaft wie Elimanes Verschwinden." Irene Binal, Neue Züricher Zeitung, 01.12.22 "Wie gut Sarr in der Literatur zuhause ist, beweist er mit diesem kunstvoll arrangierten, auf mehreren Erzählebenen wandelnden Roman, der letztendlich die Geschichte von zwei Suchen ist." Gerrit Bartels, Tagesspiegel, 01.12.22 "Das Buch liest sich stellenweise wie eine Karikatur auf den Literaturbetrieb ..." Barbara Beer, Kurier, 04.12.22 "Meine Freude beim Lesen des Romans war dermaßen groß, dass ich am liebsten eine Besprechung nur aus Zitaten des Buches liefern wollte. ... Das Buch, über ein ganzes Jahrhundert und drei Kontinente weit ausgreifend, verführt seine Leser mit einem sanft schwebenden Ton. ... Es macht satt und schlägt Funken aus der kulturellen Zweideutigkeit, die laut Sarr der Boden der afrikanischen Schriftsteller in Europa ist." Brigitte Neumann, Bayern 2 Diwan, 27.11.22 "Ein umwerfender Roman." Niklas Maak, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, 27.11.22 "Sarr changiert collagenartig zwischen Tagebucheinträgen, Zeitungsartikeln, Monologen, träumerischeren Elementen. Was kompliziert klingt, entfacht einen ungeheuren Sog. Das liegt an seinem Stil, seiner Sprache, seiner Detektivgeschichte, die Leserinnen und Leser in einen Bann zieht. Gemeinsam mit Diégane betreten sie ein Labyrinth, verlieren sich darin, finden zurück auf den Weg, und wenn sie herauskommen, werden sie nicht mehr so sein wie vorher." Enrico Ippolito, Der Spiegel, 26.11.22 "Rasant und anspielungsreich ... Sarrs vielschichtiger Roman ist eine glänzende Satire auf den französischen und frankophonen Literaturbetrieb und eine Annäherung an das, was (Welt-)Literatur im Kern ausmacht. ... Ein spannender wie ein Krimi geschriebener Roman, den man wegen seines frechen, frischen, respektlosen Tons atemlos bis zum Ende verschlingt." Dirk Fuhrig, Deutschlandfunk Kultur, 24.11.22 "Wenn man dieses Buch besinnungslos beiseitelegt, dann schläft man erschöpft ein und träumt von dem Buch schlechthin, dem vollkommenen Buch, das es doch geben müsste, aber gar nicht geben kann, und man erinnert sich vielleicht vage daran, dass man doch irgendwann einmal darin geblättert hat." Alexander Solloch, NDR, 24.11.22 "Große Literatur ... Abenteuer- und Entwicklungsroman, Detektiv- und Liebesgeschichte, poetisch, metaliterarisch, hochgeistig und trotzdem sinnlich. Es ist auch unterhaltsam und mit sprachlicher Verve erzählt, stellenweise sogar unverschämt witzig. Sie hören, ich bin begeistert, denn hier ist einem Autor tatsächlich die Quadratur des Kreises gelungen." Jerome Jaminet, mdr, 23.11.22 "Der perfekte Roman! ... Eine Feier, des Schreibens, des Lesens und der Literaturgeschichte, aber auch ein politisches Buch." Katrin Schumacher, mdr, 23.11.22 "Ein gewaltiger Roman ... Der entscheidende Verführungseffekt beruht darauf, dass seine Leserinnen und Leser die lebensverändernde Wirkung von Literatur kennen oder sie zumindest ahnen. Dieses Gefühl hält einen fest in all den Strudeln, durch die man lesend gerissen wird. Manchmal erscheint das Buch so logisch wie ein guter Krimi, manchmal brennt es wie eine große Liebesgeschichte, oft greift der Autor in gesellschaftliche Fragen der Gegenwart. ... Man kann darin versinken!" Cornelia Geißler, Frankfurter Rundschau, 23.11.22 "Ein aufregender Roman, der alle Rahmen sprengt." Annabelle Hirsch, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 20.11.22 "Ein herausragendes Buch, sehr zeitgenössisch und sehr literarisch." Dirk Fuhrig, Deutschlandfunk Kultur, 03.11.22