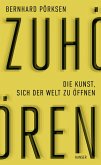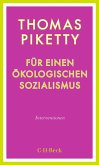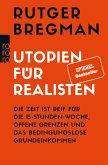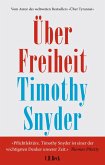Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.
Frankfurter Rundschau
?Zwei intellektuelle Superstars der Gegenwart?
DIE ZEIT, Elisabeth von Thadden
?Anspruchsvoll und anregend??
HÖRZU, Thomas Schürmann
?Wer die Welt, wer diese Zeit verstehen will, der lese dieses Buch.?
Frankfurter Rundschau, Michael Hesse
?150 gut lesbare Seiten?
WELT am Sonntag, Jakob Hayner
?Eine angenehme, aufrührende Lektüre.?
Deutschlandfunk, Martin Tschechne
?Michael Sandel ? wägt seine Worte sorgfältig ab ? und doch fesseln seine scharfsinnigen Analysen ? Zusammen mit dem Pariser Ökonomen Thomas Piketty beschäftigt er sich in seinem neuen Buch ? mit wachsender sozialer Ungleichheit, dem Klimawandel, dem Aufstieg der Rechten und der Zukunft der Linken.?
STERN Plus, Nicolas Büchse
?Nach einer längeren Unterbrechung habe die Erforschung sozialer Ungleichheit wieder Fahrt aufgenommen, vor allem dank Thomas Piketty.?
philosophie Magazin, Christoph Bartmann
?Interessant wird der Diskurs immer dann, wenn er, allen Übereinstimmungen im egalitären Freiheitsbegriff zum Trotz, unterschiedliche strategische Perspektiven einer demokratischen Linken erkennen lässt?
socialnet.de, Peter Flick
?Ein leicht zu lesender und sehr verständlicher Dialog?
Spektrum der Wissenschaft, Josef König
?Der Ökonom Thomas Piketty und der Philosoph Michael J. Sandel diskutieren Gleichheits- und Gerechtigkeitsfragen. Ihnen lesend zu folgen ist ein Gewinn.?
taz, Michael Wolf
?Man sollte dieses Buch nicht nur lesen, wenn man eine etwas genauere Ahnung davon bekommen möchte, warum die Welt gerade ist, wie sie ist. Man sollte es lesen, damit man nicht vergisst, dass gar nicht so unklar ist, was zu tun wäre.?
Süddeutsche Zeitung, Jens-Christian Rabe
?Der Dialog der beiden ist keine akademische Übung, sondern fundierte Analyse und politische Handlungsanweisung zugleich.?
Manager Magazin, Kai Lange
?Fast in einem Rutsch gelesen. Das Gesprächsformat ist klug gewählt und ermöglicht es, den Ausführungen der beiden Denker über Gleichheit und Gerechtigkeit gut zu folgen ? immer fundiert.?
Harvard Businessmanager, Gesine Braun
?Die Diskussion ist absolut nachvollziehbar.?
SWR Kultur lesenswert, Jochen Rack
?Hellsichtige Diagnosen?
Monopol, Silke Hohmann
?Wenn sich zwei renommierte Professoren über Demokratie und Gerechtigkeit unterhalten, entsteht ein spannendes und hochaktuelles Werk.?
Darmstädter Echo, Andreas Müller
Frankfurter Rundschau
Zwei intellektuelle Superstars der Gegenwart
DIE ZEIT, Elisabeth von Thadden
Anspruchsvoll und anregend
HÖRZU, Thomas Schürmann
Wer die Welt, wer diese Zeit verstehen will, der lese dieses Buch.
Frankfurter Rundschau, Michael Hesse
150 gut lesbare Seiten
WELT am Sonntag, Jakob Hayner
Eine angenehme, aufrührende Lektüre.
Deutschlandfunk, Martin Tschechne
Michael Sandel wägt seine Worte sorgfältig ab und doch fesseln seine scharfsinnigen Analysen Zusammen mit dem Pariser Ökonomen Thomas Piketty beschäftigt er sich in seinem neuen Buch mit wachsender sozialer Ungleichheit, dem Klimawandel, dem Aufstieg der Rechten und der Zukunft der Linken.
STERN Plus, Nicolas Büchse
Nach einer längeren Unterbrechung habe die Erforschung sozialer Ungleichheit wieder Fahrt aufgenommen, vor allem dank Thomas Piketty.
philosophie Magazin, Christoph Bartmann
Interessant wird der Diskurs immer dann, wenn er, allen Übereinstimmungen im egalitären Freiheitsbegriff zum Trotz, unterschiedliche strategische Perspektiven einer demokratischen Linken erkennen lässt
socialnet.de, Peter Flick
Ein leicht zu lesender und sehr verständlicher Dialog
Spektrum der Wissenschaft, Josef König
Der Ökonom Thomas Piketty und der Philosoph Michael J. Sandel diskutieren Gleichheits- und Gerechtigkeitsfragen. Ihnen lesend zu folgen ist ein Gewinn.
taz, Michael Wolf
Man sollte dieses Buch nicht nur lesen, wenn man eine etwas genauere Ahnung davon bekommen möchte, warum die Welt gerade ist, wie sie ist. Man sollte es lesen, damit man nicht vergisst, dass gar nicht so unklar ist, was zu tun wäre.
Süddeutsche Zeitung, Jens-Christian Rabe
Der Dialog der beiden ist keine akademische Übung, sondern fundierte Analyse und politische Handlungsanweisung zugleich.
Manager Magazin, Kai Lange
Fast in einem Rutsch gelesen. Das Gesprächsformat ist klug gewählt und ermöglicht es, den Ausführungen der beiden Denker über Gleichheit und Gerechtigkeit gut zu folgen immer fundiert.
Harvard Businessmanager, Gesine Braun
Die Diskussion ist absolut nachvollziehbar.
SWR Kultur lesenswert, Jochen Rack
Hellsichtige Diagnosen
Monopol, Silke Hohmann
Wenn sich zwei renommierte Professoren über Demokratie und Gerechtigkeit unterhalten, entsteht ein spannendes und hochaktuelles Werk.
Darmstädter Echo, Andreas Müller