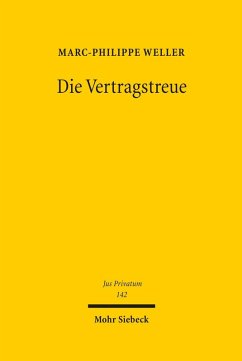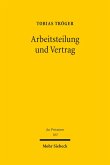Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.

Ein flammendes Plädoyer für den Vertrag
Ein paar Kenntnisse von Recht und Latein gehören zur Allgemeinbildung. "Pacta sunt servanda" lautet solch ein geflügeltes Wort, das fast jeder kennt. Doch warum sind Verträge eigentlich einzuhalten, wie es dieses Grundprinzip des Zivilrechts gebietet? Antworten darauf versucht der Mannheimer Rechtswissenschaftler Marc-Philippe Weller in einem Buch zu geben, das er kurz und bündig "Die Vertragstreue" getauft hat. Der frühere Rechtsanwalt und jetzige Hochschullehrer verbindet darin Rechtsdogmatik mit Ökonomie und Ethik. Zudem untersucht er das Gebot der Vertragstreue in der historischen Entwicklung und im Vergleich mit dem britischen "Common Law".
Für Weller sind Vertragstreue und Vertragsfreiheit kein Widerspruch, sondern zwei Seiten derselben Medaille: Zur Selbstbestimmung des Einzelnen gehöre eben auch die Freiheit, sich selbst zu binden. Als Ausdruck der Privatautonomie sei dies der "wichtigste Pfeiler einer liberalen Marktwirtschaft", schreibt er unter Berufung auf den Ökonomen Adam Smith. Die Vertragsbindung führe zu Vertrauensschutz, Rechtssicherheit und Planbarkeit - und damit zur Senkung von Transaktionskosten.
Die Vorstellung einer zweiseitigen Versprechensbindung findet sich demnach schon beim Philosophen Immanuel Kant. Verfassungsrechtlich verbürgt werde die Vertragsfreiheit heutzutage überdies von Grundgesetz und Bundesverfassungsgericht, wobei die Begründung von der Menschenwürde über die allgemeine Handlungsfreiheit bis hin zum Grundrecht auf Eigentum reicht. Auch der Europäische Gerichtshof akzeptiert das Recht auf Selbstverantwortung beim geschäftlichen Vertragsschluss, wie Weller hervorhebt.
Die Bindung an einen einmal geschlossenen Vertrag hat nicht nur Vorteile für den Gläubiger der "Hauptleistung" (also den Kunden), der auf Lieferung der bestellten Ware oder Erbringung einer Dienstleistung wartet. Auch ein Unternehmen, das etwa auf Bestellung ein aufwendiges Werkstück angefertigt hat, besitzt nicht nur ein Interesse an der Zahlung des Kaufpreises - es will das sperrige Produkt auch "vom Hof" haben. Schuldner sind vielfach auf die Mitwirkung des Abnehmers angewiesen. Aus gutem Grund besitzen sie deshalb das Recht, ihre Leistung in Naturalreform zu erbringen.
Umgekehrt muss sich der Besteller nicht vorschnell mit einer ersatzweisen Zahlung von Schadensersatz abspeisen lassen. Mit dieser Begründung weist Weller die "Death of Contract-Doktrin" genannte These zurück, nach der Vertrag und Delikt - also die Gesetzesregeln zur Haftung etwa für die Beschädigung eines fremden Gegenstands - letztlich ein und dieselbe Rechtsgrundlage darstellten. Für Weller hat die vertragliche Abmachung eine "königliche Stellung" im System des Privatrechts. Dieses Alleinstellungsmerkmal begründet er damit, dass es sich um ein freiwillig geschaffenes Schuldverhältnis mit "schneidigen Rechten" handele.
Für eine Habilitationsschrift ist das Werk erstaunlich flott zu lesen, und es ist ungewöhnlich aktuell. So führt Weller die Gesetze zur Stabilisierung des Finanzmarkts als Beispiel für Einschränkungen der Vertragsfreiheit an. Die darin vom Bundestag verfügte Deckelung der Gehälter von Managern, deren Banken vom Staat vor dem Ruin bewahrt werden mussten, hält der Jurist für gerechtfertigt: Schließlich habe der Steuerzahler die Rettung bezahlt.
Auch in den durch EU-Richtlinien ausgeweiteten Bestimmungen zum Verbraucherschutz im Bürgerlichen Gesetzbuch erblickt Weller keinen Widerspruch zur Vertragsfreiheit der betroffenen Unternehmen. Denn in bestimmten Situationen sei nun einmal ein Recht zum begründungslosen Widerruf eines Kontrakts nötig, damit beide Parteien sich überhaupt "auf Augenhöhe" begegnen könnten. Das Gebot der Gerechtigkeit hält der Forscher jenen Kritikern entgegen, die in diesem einseitigen Lösungsrecht bereits das Prinzip "pacta non sunt servanda" wittern.
JOACHIM JAHN
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main