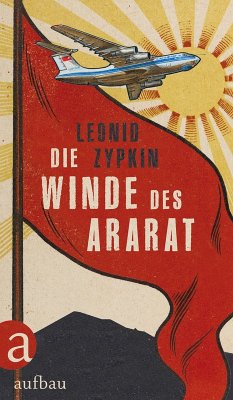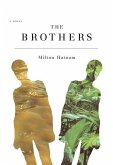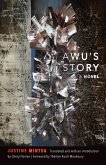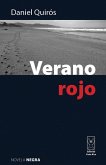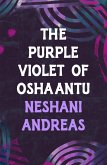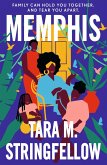Die Sowjetunion in den 1970er Jahren. Boris Lwowitsch, Jurist jüdischer Abstammung aus Moskau, und seine Frau Tanja machen in einer armenischen (und damals zur Sowjetunion gehörenden) Grenzstadt mit Blick auf den in der Türkei liegenden Ararat Urlaub. Die Nähe der unüberwindbaren Grenze und der
dahinterliegenden Freiheit ist dem Ehepaar bewusst, aber ein Thema, über das man nicht spricht. Boris…mehrDie Sowjetunion in den 1970er Jahren. Boris Lwowitsch, Jurist jüdischer Abstammung aus Moskau, und seine Frau Tanja machen in einer armenischen (und damals zur Sowjetunion gehörenden) Grenzstadt mit Blick auf den in der Türkei liegenden Ararat Urlaub. Die Nähe der unüberwindbaren Grenze und der dahinterliegenden Freiheit ist dem Ehepaar bewusst, aber ein Thema, über das man nicht spricht. Boris und Tanja spulen mit den übrigen Touristen ihr Programm ab, bis ihr Urlaub einen jähen Abbruch findet, als sie wegen des angeblichen Endes ihrer Buchungszeit aus ihrem Hotel ausquartiert werden. Ein Versuch Boris’, sich für diese entwürdigende Behandlung an der Hoteldirektorin zu rächen, bringt kaum Befriedigung. Und dann wartet Zuhause in Moskau noch eine Veränderung, die Boris’ und Tanjas Leben für immer verändern wird.
Leonid Zypkin macht es den Lesern seiner autobiografisch beeinflussten Erzählung „Die Windes des Ararats“ nicht leicht. In einem dahinplätschernden Strom folgen wir Boris durch seine Gedanken, springen mit ihm durch Themen und Zeiten bis hin zur Kreuzigung Jesu und zur Massenvernichtung der Juden während des Zweiten Weltkrieges. Oder zumindest nehmen wir an, dass wir das tun. Denn mit der Nennung von Namen, Orten und Ereignissen ist Boris bzw. Zypkin mehr als sparsam. Als Leser muss man sich entweder auskennen, schlaumachen oder gleichgültig bleiben.
Sparsam ist Zypkin auch mit seiner Punktierung. Als ich einmal eine Lesepause einlegen wollte, habe ich sechs Seiten nach dem nächsten Punkt gesucht. Ohne Erfolg. Ab da habe ich mehr oder weniger wahllos Wörter mitten im Text markiert, wann immer ich eine Unterbrechung gebraucht habe. Ich weiß nicht, ob es an diesem Punktierungsgeiz oder am Stil lag, aber es war mir fast unmöglich, mich auf den Text zu konzentrieren. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal beim Lesen so konsequent abgeschweift bin, wie bei dieser Erzählung.
Eigentlich habe ich keine guten Gründe, „Die Winde des Ararats“ gemocht zu haben. Abgesehen von den oben erwähnten Problemen hat mir die Geschichte auch sonst wenig von dem gegeben, was ich normalerweise in einer von mir als gut bezeichneten Lektüre suche. Die Geschichte war – ich würde nicht sagen, nicht vorhanden, aber definitiv nicht spannend oder auch nur unterhaltend. Eine tiefere Aussage hat sich mir zumindest nicht erschlossen, auch wenn sie bestimmt irgendwo vorhanden war. Es hat sich für mich nur wenig an neuen Perspektiven und Gedanken aufgetan. Und vor allem war alles so in der Schwebe, dass ich keine Aussage machen könnte, ohne mich zu fragen, ob ich einfach nur fleißig hineininterpretiere.
Und trotzdem hat mich etwas im Nachhinein auf positive Weise mit diesem Roman verknüpft. Etwas, was ich schwer benennen kann, hat sich bei mir eingepflanzt und lässt mich mit mehr Begeisterung an dieses Buch zurückdenken, als ich beim Lesen tatsächlich empfunden habe. Vielleicht ist es die Figur des Boris Lwowitsch, seine Menschlichkeit in allen Facetten. Vielleicht die Atmosphäre, die Zypkin zu schaffen weiß. Vielleicht eine tiefere Wahrheit, die nicht genannt, aber empfunden wird.
Leonid Zypkin, der nach der Ausreise seiner Frau und seines Sohnes in die Staaten seinen Doktortitel aberkannt bekam und in seinem Beruf als Mediziner herabgestuft wurde, schrieb zu seinen Lebzeiten fast ausschließlich für die Schublade. Kein sowjetischer Verlag war bereit, etwas von ihm zu veröffentlichen, so dass er seinen bekanntesten Roman „Ein Sommer in Baden-Baden“ außer Landes schmuggeln musste, der nur eine Woche vor seinem Tod in einer Emigranten-Zeitung in New York veröffentlicht wurde. Vielleicht ist dieses für sich schreiben, für seine Zeit schreiben, für seine Situation schreiben der Grund, dass mir das Lesen so schwergefallen ist. Trotzdem bin ich mir sicher, dass es für die literarische Welt ein Segen ist, dass sein Werk letztendlich doch seinen Weg an die Öffentlichkeit gefunden hat und in Deutschland zu den neu aufgelegten Wiederen