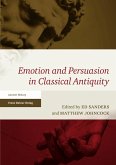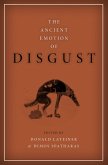Nach gängiger Auffassung entstand der Rechtsstaat durch die Zähmung der barbarischen Natur des Menschen: Archaische und vormoderne Gesellschaften seien von Konflikten um Ehre und Rache regiert worden, deren Macht im langwelligen Prozess der Zivilisierung gebrochen wurde. Durch Aufklärung und Modernisierung sei die von den Ehrgefühlen entzündete Gewalt wieder eingehegt worden und Humanität an die Stelle der Triebnatur des Menschen getreten - so die gängige Annahme. Dieses Buch zeigt am Beispiel der griechischen Antike auf, dass die Gefühle, die wir gemeinhin mit Ehre und Rache verbinden, durch das antike Recht überhaupt erst geschaffen wurden. Es leistet einen wichtigen Beitrag zu einer politischen Theorie der Wirksamkeit des Rechts und fügt der Gewaltgeschichte des Menschen in der frühgriechischen Antike eine unerwartete Wendung hinzu.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.