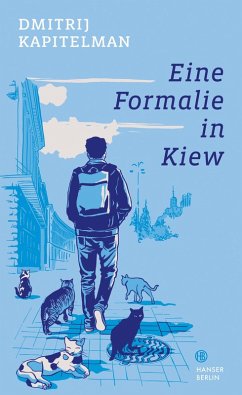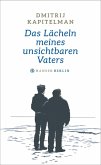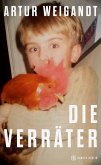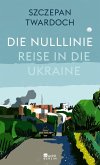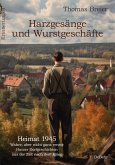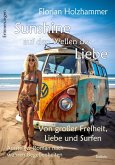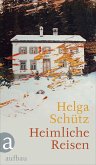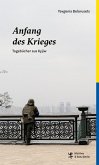Dmitrij Kapitelman erzählt von einer Familie, die in die Fremde zog, um ein neues Leben zu beginnen, und am Ende ohne jede Heimat dasteht. "Erst durch dieses Buch ist das Verstehen der Migration, des Nicht-Dazugehörens und des Dazwischen möglich." Olga Grjasnowa "Eine Formalie in Kiew" ist die Geschichte einer Familie, die einst voller Hoffnung in die Fremde zog, um ein neues Leben zu beginnen, und am Ende ohne jede Heimat dasteht. Erzählt mit dem bittersüßen Humor eines Sohnes, der stoisch versucht, Deutscher zu werden. Dmitrij Kapitelman kann besser sächseln als die Beamtin, bei der er den deutschen Pass beantragt. Nach 25 Jahren als Landsmann, dem Großteil seines Lebens. Aber der Bürokratie ist keine Formalie zu klein, wenn es um Einwanderer geht. Frau Kunze verlangt eine Apostille aus Kiew. Also reist er in seine Geburtsstadt, mit der ihn nichts mehr verbindet, außer Kindheitserinnerungen. Schön sind diese Erinnerungen, warten doch darin liebende, unfehlbare Eltern. Und schwer, denn gegenwärtig ist die Familie zerstritten.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D, L ausgeliefert werden.
"Keiner kann wie Dmitrij Kapitelman neue Begriffe erfinden, unvergleichlich ist seine melancholische Leichtigkeit, mit der er tieftraurige Dinge erzählen kann." Brigitte Bücher Sonderheft, 2/2021 "Die Zärtlichkeit mit der Kapitelman seine Figuren zeichnet, ist berührend. ... Eine kurzweilige und angenehme Lektüre ist dieses Buch, das uns einer beiläufigen Schönheit schildert, wie eine Familie letztendlich auch in all ihrer Heimatlosigkeit beieinander bleiben und neu zueinander finden kann." Jonathan Böhm, SWR 2, 08.06.21 "Kapitelman ist ein brillanter Erzähler, lustig, selbstironisch und mit klarem Blick. Eine Formalie in Kiew erzählt davon, wie nah die Ukraine Europa eigentlich ist." Tobias Rapp, Spiegel online, 07.03.22 "Tragisches und Komisches sind ganz nah beieinander. Ein junges, frisches Buch und ein schönes Plädoyer für mehr Menschlichkeit und weniger Bürokratie." Melanie Fischer, Deutschlandfunk Kultur Lesart, 07.05.21 "Kapitelman hat einen wachen Blick und beweist in seinem Roman eine enorme Beobachtungsgabe. Dieses Buch zu lesen ist ein großes Vergnügen. ... ein großes Sprachtalent." WDR 2, 10.03.21 "Kapitelman verhandelt .. ein Bewusstsein für die Fluidität von Zugehörigkeiten, den Wandel und das Nebeneinander von Identitäten, für Widersprüche, die nur von außen wie Widersprüche wirken." Sonja Zekri, Süddeutsche Zeitung, 06.03.21 "Das ist ungeheuer liebevoll ... es ist so, dass es einem die Tränen der Rührung in die Augen treibt. Man möchte diesem Autor danken für diesen wunderschönen Text." Annemarie Stoltenberg, NDR Kultur, 02.03.21 "Es liest sich gut weg. Kapitelmann ... hat einen hat einen eingängigen Sound, den bewies er schon im wunderbaren Debüt "Das Lächeln meines unsichtbaren Vaters". Auch in der "Formalie" findet er an der richtigen Stelle zärtliche Worte." Andreas Scheiner, Neue Zürcher Zeitung am Sonntag, 28.02.21 "Ein sprachliches Feuerwerk. ... Dmitrij Kapitelman erzählt mit viel Humor und sprachlicher Fantasie ... immer wieder erfrischend selbstironisch. ... Er vermittelt auf eindrückliche Weise die prekäre Situation des zwischen den Stühlen sitzenden Migranten, der dazu noch von den ambivalenten Gefühlen gegenüber seinen Eltern gebeutelt wird." Fokke Joel, Die Tageszeitung, 22.02.21 "Zum Heulen witzig ... Dieses Buch nimmt mit auf eine sehr persönliche Reise in ein Land, das allen Klischees widerspricht, um einige dann doch, aber anders als erwartet, zu bestätigen. Es führt in eine vieldeutige Sprachwelt ein ... und ist vor allem eine Einladung zum Dialog." Natascha Freundel, rbb Kulturradio, 09.02.21 "Solche Passagen, wie sie Kapitelman gelingen, kann kaum ein Gegenwartsautor in dieser heiteren Anmut und Zärtlichkeit unserer Sprache entlocken. ... Man begleitet diesen Helden und lässt sich verzaubern von einem schier unverwüstlich wirkenden Glauben an Menschlichkeit." Annemarie Stoltenberg, NDR Kultur, 02.02.21 "Kapitelman erzählt voller Witz, Wärme und Esprit. ... Dmitrij Kapitelman schreibt witzig wie Sasa Stanisic, zärtlich-sentimental wie Joseph Roth und ethnografisch genau wie Emilia Smechowski." Marc Reichwein, Die Welt, 30.01.21 "Lehrreich, vor allem aber mit einem wunderbaren Humor beschrieben. Das macht stilistisch Freude, ist wortgewandt und gedankentief." Matthias Schmidt, MDR Kultur, 27.01.21 "Es geht Kapitelman stark ums Sprachliche. Nicht nur, dass er sächsischen Zungenschlag gut schriftlich zu imitieren weiß, er liefert in seinem Buch auch eine Sprachphänomenologie des Postsozialismus. Und das nicht in platt denunziatorischer Weise, sondern satirisch zugespitzt vor allem über seine Eigenschaft als Doppelsprachler: ... So dient "Eine Formalie in Kiew" auf höchst intelligente Weise der Völkerverständigung - im buchstäblichen Sinne. Obwohl das Buch voller Klischees steckt, deren Richtigkeit es aber lustvoll zu belegen versteht." Andreas Platthaus, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 27.01.21 "Kapitelman stößt eine Lachluke auf, durch die Licht in die düsteren Debatten unserer Zeit dringt. ... Er hat ein zärtliches Buch geschrieben: zärtlich seiner alten Heimat gegenüber und seiner neuen, seinem Vaterland und seiner Muttersprache, seinem Papa und seiner Mama. Ein Buch mit zärtlichem Humor vor allem, jeder Witz eine Liebkosung. Eine große Eltern-Sohn-Liebesgeschichte, ein Plädoyer für mehr Herz und weniger Formalien." Tobias Becker, Spiegel Online, 25.01.21 "Ein wunderbar tragisch-komisches Buch über die Auswirkungen von Migration." Mareike Ilsemann, WDR5, 23.01.21 "Dmitrij Kapitelman erzählt seelenvoll und produziert doch in keinem Moment Kitsch. Sein Roman ist eine 'schmerzsozialisierte', dabei unverhohlen zärtliche Liebeserklärung an ein Elternpaar, dem es nicht gegeben war, in Deutschland heimisch zu werden. Dass Nationalitäten etwas Gleichgültiges sind und nicht wert, Bindungen zu ruinieren, ist das Resümee der meisterhaft unbeschwert erzählten und doch so traurigen Geschichte." Sigrid Brinkmann, Deutschlandfunk Kultur, 21.01.21