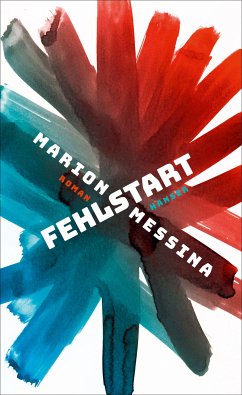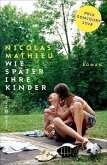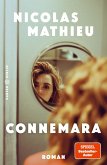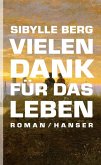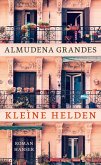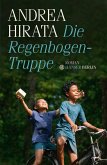"Houellebecq hat eine Erbin." (Marianne). Marion Messina blickt auf das Leben und Scheitern einer jungen Frau in Paris - ihr furioses Debüt ist ein Stich ins Herz unserer krisengeschüttelten Gegenwart. Als ihre erste Liebe scheitert, zieht die neunzehnjährige Aurélie von Grenoble nach Paris. Dort will sie endlich in vollen Zügen leben und mit ihrem Jurastudium die provinziellen Arbeiterbiographien ihrer Eltern hinter sich lassen. Aber in Paris reicht es gerade mal für einen Job als Empfangsdame, der Wohnungsmarkt entpuppt sich als anarchische Zone und die Liebe ist eine Farce zwischen freundlichen Arrangements und Pornographie. Doch dann setzt Aurélie alles auf Anfang. Voll Zorn, Klarsicht und gnadenloser Ironie blickt Marion Messina auf das Leben einer jungen Frau und ins Innerste einer neuen verlorenen Generation. "Ein furioses Debüt; beißend und unverschämt gut geschrieben" (Le Monde).
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D, L ausgeliefert werden.

© BÜCHERmagazin, Elisabeth Dietz (ed)
"'Fehlstart' ist ein wütender Aufschrei, der zum Glück nun auch bei uns Gehör findet." Dina Netz, WDR3 Mosaik, 02.03.2020 "Schon auf den ersten Seiten fasziniert der nur vordergründig sachliche, pointierte Ton von Marion Messina. ... 'Fehlstart' ist ein in seiner Hellsichtigkeit erstaunliches und herzzerreißendes Buch - an dessen Ende zumindest beim Leser aus der Frustration Wut erwächst." Katja Weise, NDR Kultur, 13.02.2020 "Marion Messina besticht durch überraschende Beobachtungen und ungewohnte Biografien - bis hin zu ihren liebevoll gnadenlosen Eltern-Porträts. Hier schreibt eine Autorin, die auf die immer ungemütlicheren französischen Alltags-Realitäten mit tabulosem Witz und verbaler Schlagkraft reagiert." Christoph Vormweg, Deutschlandfunk Büchermarkt, 12.02.2020 "Der neue Stern am französischen Schriftstellerinnenhimmel. Sie gibt vor allem den vielen jungen Menschen eine literarische Stimme, die genau wie ihre Protagonistin Aurelie weiterkommen wollen im Leben, aber durch das aktuelle politische System ständig ausgebremst werden." ZDF aspekte, 31.01.20 "'Houellebecqs Erbin' ist Marion Messina in Frankreich genannt worden. Das stimmt einerseits, denn Messina schreibt wie Houellebecq pointiert und gnadenlos. ... Andererseits schreibt Messina nicht so kalt wie Houellebecq. Sie leidet spürbar mit ihren Figuren, die für ihr Scheitern wenig können, sondern sich schlicht an der französischen Wirklichkeit aufreiben. ... Marion Messina beschreibt in gestochen scharfen Bildern eine Generation, der die Hoffnung fehlt." Dinia Netz, WDR 5, 31.01.20 "Marion Messina hat mit 'Fehlstart' eine fulminante Coming-of-Age-Geschichte weiblicher Sexualität geschrieben - dringlich und vehement. ... [Sie] verfügt über den selbstsicheren Sound einer mit soziologischem Röntgenblick ausgestatteten Schriftstellerin." Meike Feßmann, Deutschlandfunk Kultur, 30.01.2020