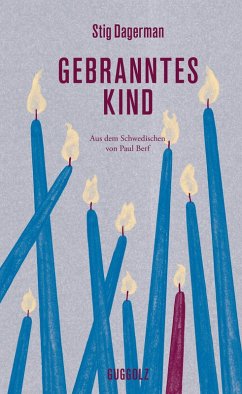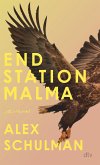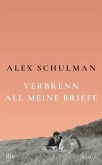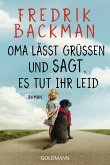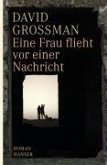Stockholm, in den 1940er-Jahren: Während der 20-jährige Bengt um seine heißgeliebte Mutter trauert, tröstet sich sein Vater Knut längst mit einer neuen Frau. Die Kinokartenverkäuferin Gun erbt nicht nur Almas rotes Kleid, das dieser ohnehin nie passte, sondern auch die Liebe des Schreiners. Doch
Bengt lehnt die neue Frau an der Seite des Vaters strikt ab. Als er gemeinsam mit seiner Freundin Berit…mehrStockholm, in den 1940er-Jahren: Während der 20-jährige Bengt um seine heißgeliebte Mutter trauert, tröstet sich sein Vater Knut längst mit einer neuen Frau. Die Kinokartenverkäuferin Gun erbt nicht nur Almas rotes Kleid, das dieser ohnehin nie passte, sondern auch die Liebe des Schreiners. Doch Bengt lehnt die neue Frau an der Seite des Vaters strikt ab. Als er gemeinsam mit seiner Freundin Berit an einem familiären Trip auf die Schären teilnimmt, brechen sich die Emotionen Bahn...
"Gebranntes Kind" ist ein Roman des Autors Stig Dagerman (1923 - 1954), der im schwedischen Original 1948 erschienen ist. 1967 wurde er verfilmt (deutscher Titel: Ich - seine Geliebte), 1983 sowohl in der BRD, als auch in der DDR erstmals ins Deutsche übersetzt. Nun ist bei Guggolz eine deutsche Neuübersetzung von Paul Berf erschienen, die durch ein kompaktes und informatives Nachwort des schwedischen Schriftstellers Aris Fioretos komplettiert wird. Nach "Deutscher Herbst" ist "Gebranntes Kind" bereits das zweite Werk Dagermans bei Guggolz. Kein Wunder, passt "Bränt barn", so der Originaltitel, in seiner Mischung aus sprachlicher Extravaganz und ambivalenter Figurenzeichnung doch ganz hervorragend in das Guggolz-Beuteschema, wie beispielsweise im letzten Jahr auch Tom Kristensens "Absturz".
Wobei "Gebranntes Kind" tatsächlich noch stärker polarisieren dürfte, denn es ist ein durch und durch unbequemer Roman. Das beginnt mit den kurzen, stakkatohaften Sätzen, die Dagerman seinen Leser:innen förmlich um die Ohren haut, mischt sich mit pathetischen Briefen der Hauptfigur und mündet schließlich in einem Protagonisten, der vor physischer und psychischer Gewalt gegen Frauen und Tiere nicht zurückschreckt. Ständig arbeitet Dagerman zudem mit Symbolen und Gegensätzen wie "schön" und "hässlich", die man schon nach dem ersten Kapitel als anstrengend empfindet.
Womit wir beim großen "Aber" wären. Denn die kurzen Sätze, die - einem Schüleraufsatz gleich - gern auch mit "Und" oder "Dann" beginnen, sind so voller Tiefe, dass man beim ersten Lesen kurz zusammenzuckt. "Der Sohn ist zwanzig und nichts", heißt es an einer Stelle, an einer anderen "die Welt fürchtet den, der weint". Das ist schmerzhaft und klug. Die Briefe sind nicht nur pathetisch, sondern zerbersten fast vor lauter Emotionalität, die bisweilen an die biblischen Propheten erinnert. Gekonnt setzt Dagerman mit ihnen eine Art Kontrapunkt zu den nüchtern anmutenden Erzählpassagen, die sich nicht einmal trauen, die Namen der Figuren zu nennen. Meisterlich ändert sich in ihnen der Tonfall zur Stimmung von Hauptfigur Bengt. Die Briefe "von ihm selbst an ihn selbst" sind zunächst voller Trauer über die Mutter und Wut auf den Vater, die Freundin, ach eigentlich die ganze Welt. Später öffnet sich Bengt und schreibt "an eine junge Frau" und gar "an eine Insel", und Teile dieses letzten Briefes erinnern in ihrer überbordenden Zärtlichkeit an den Sturm und Drang, vielleicht an eine Art "Werther 2.0".
"Gebranntes Kind" ist ein forderndes und herausforderndes Werk, das nicht gefällig ist, aber auch gar nicht gefallen will. Es ist schmerzhaft und schrecklich. Und dennoch ist es ein großes Buch, das mit bemerkenswerter Präzision das Innenleben eines Charakters emotional und stilistisch so außergewöhnlich kunstvoll präsentiert. Bengt trägt das gesamte Buch, es gibt keine Szene, die ohne ihn auskommt. Wenn er leidet, leidet der Roman. Wenn er liebt, blüht der Roman auf. Er dürfte eine der wohl widersprüchlichsten Hauptfiguren der Literaturgeschichte sein, ein klassischer Antiheld. Es fällt leicht, ihn auf den ersten Blick zu hassen. Doch betrachtet man sein Innenleben - und das ist bei der Lektüre unabdingbar - erkennt man die Zerrissenheit dieses jungen Mannes, seinen wahrhaftigen Schmerz über den Verlust der Mutter, seine Gefühle, von denen er nicht weiß, wohin damit.
Es ist eine kühne Entscheidung Stig Dagermans, einen solchen Protagonisten erschaffen zu haben, der vornehmlich auf Ablehnung stoßen wird, ohne ihm eine ebenbürtige positiv besetzte Figur entgegenzusetzen. Liest man aber die biographischen Angaben zu Dagerman im Anhang und im Nachwort, so konnte es eigentlich keine andere Entscheidung geben. Denn unglückliche Todesfälle, Schreibblockaden und schließlich der Suizid sechs Jahre nach Erscheinen des Romans machen aus Dagerman selbst ein "gebranntes Kind".