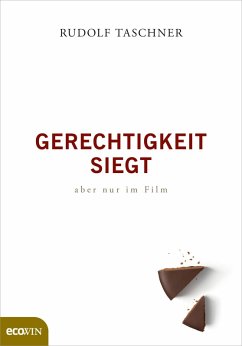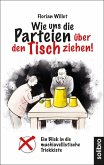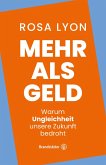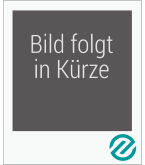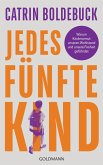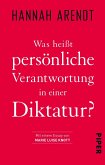Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.

Frühe Investitionen in Bildung sind besser als spätere Transfers
Ist der Markt gerecht? Nein, sagt der österreichische Mathematiker Rudolf Taschner und fügt hinzu: "Der Markt ist aber auch nicht ungerecht. Das wäre er nur, wenn er ungerechte Unterschiede schaffen wollte." Aber der Markt besitze keinen zielgerichteten Willen. Vielmehr scheine das Marktgeschehen chaotisch zu sein. Taschner führt Aktienkurse als Beleg an, die er als wirre auf und ab strebende Kurven in einem Koordinatensystem bezeichnet. Der Wissenschafter hat sich in seinem Buch "Gerechtigkeit siegt - aber nur im Film" auf die Suche nach der Gerechtigkeit gemacht und ist dabei gescheitert, wie er gleich zu Beginn seines Buchs feststellt: "Es gibt keine Gerechtigkeit, zumindest nicht auf Erden."
Auf seiner Suche unternimmt Taschner Ausflüge in so ziemlich jede Wissenschaftsdisziplin, angefangen von der Biologie und Physik über die Philosophie, die Wirtschaftswissenschaften bis zur Rechtswissenschaft und endet schließlich bei der Religion. Ganz verbergen kann Taschner seinen Brotberuf aber nicht: Anhand vereinfachter mathematischer Modelle analysiert er beispielsweise die Rentenproblematik beim Umlageverfahren. Welche Ansätze seien gerecht, um das sich verschlechternde Verhältnis zwischen Rentnern und Erwerbstätigen zu verbessern, wird gefragt. Die Antworten dafür und wie man für künftige Generationen für Gerechtigkeit sorgt, zeigen die Schwierigkeiten mit dem opaken Begriff der Gerechtigkeit.
Taschner räumt mit der Idee auf, wonach Menschen alle gleich geboren seien: "Die einen kommen mit weißer, die anderen mit schwarzer Haut zur Welt, als Mann, als Frau, mit guten oder mit schrecklichen Genen ausgerüstet." Die Natur sei nicht gerecht, merkt der Universitätsprofessor an. Gerechtigkeit sei ein Kunstbegriff und nicht erreichbar. Er weist anhand von Einkommensverteilungsmaßen darauf hin, dass kommunistische Regime die angebliche Gleichheit aushöhlen. Eingegangen wird auf die Wirkung von Transfers, damit die Schere zwischen Arm und Reich nicht zu groß wird. Es sei schwieriger, findet Taschner, im Nachhinein durch Transfers bereits bestehende Ungerechtigkeiten mühsam zu korrigieren, als durch Investition in Bildung die Chancen der Bürger zu verbessern.
Im lockeren Plauderton werden die verschiedenen Spielarten und Dimensionen von Gerechtigkeit vermittelt. Der Autor teilt seinen Essay in acht Abschnitte, deren Titel die Gerechtigkeit jeweils mit einem weiteren Substantiv mit "G" kombinieren: Gleichheit, Generationen, Gesetz, Geschichte, Geschäft, Gestaltung, gewissen, Gnade. Der Wissenschafter hat sich mit klugen Köpfen aus der Vergangenheit befasst und auch mit Veränderungen im Laufe der Geschichte. Er zeigt, wie alter Standesdünkel aufgehoben wurde, aber alsbald wieder neuer entstand. Man erfährt Bemerkenswertes über die Entwicklung des Genies Mozart, der wegen seiner Begabung auch ein hervorragender Mathematiker hätte werden können, aber Musiker wurde, weil sein Vater es war und sein Schicksal in der damaligen Ständegesellschaft nichts anderes zuließ.
Carl Friedrich Gauß, ein hochbegabtes Kind armer Eltern, hatte Glück, dass er in eine Zeit geboren wurde, in der der Mensch bereits als autonomes Wesen betrachtet wurde. Er erhielt eine Chance, seiner Begabung entsprechend zu arbeiten, weil ein kluger Lehrer ihn gefördert hatte und er schließlich ein Stipendium an einem Gymnasium bekam.
Taschner macht klar, dass Fortüne bei solchen Entwicklungen immer eine Rolle spielt. Das gilt aus Sicht des Autors auch für Bill Gates. Für dessen Erfindung war die Zeit reif. Hingegen war es für Blaise Pascal zu früh. Der zwanzigjährige Pascal, ein Wunderkind des 17. Jahrhunderts und in seinem intellektuellen Talent mit Mozart vergleichbar, erfand eine Rechenmaschine mit dem Namen Pascaline. Diese war ein mechanisches Wunderding. Seine Hoffnung, mit dem Gerät Geld zu verdienen, zerschlug sich jedoch. Die Rechenarbeit von Menschen war damals spottbillig, wie überhaupt die Erwerbsarbeit zur Zeit Pascals mit geringen Beträgen entlohnt wurde. Nie hätten sich damals für ein Unternehmen, in dem Rechnungen zu tätigen waren, die Anschaffungskosten einer Pascaline rentiert. Also hat, schließt Taschner, nicht Pascal die Milliarden verdient, sondern Bill Gates, der mit seinem Betriebssystem rechtzeitig kam.
Zur Sprache kommt die Französische Revolution und deren Idealbild des "Citoyen". Auch auf Theoretiker wie John Rawls wird hingewiesen. Rawls fragte im Jahre 1971 in seiner "Theorie der Gerechtigkeit", welche Grundregeln für eine Gesellschaft Personen im Voraus festlegen würden, sofern sie nicht wüssten, welche Stellung sie selbst einnehmen werden. Rawls formulierte zwei Grundsätze für Gerechtigkeit, die Taschner ebenso gut zusammenfasst wie die Schwachstellen in dem Konzept.
Taschners Analyse ist ernüchternd. Der Mathematiker kommt zum Schluss, dass selbst Glück ungerecht ist, denn man habe es meistens auf Kosten anderer. Selbst der Lottogewinn geht nach dieser Lesart auf Kosten anderer, die eben kein Glück haben. Wer es durch Fleiß und Anstrengung zu großem Reichtum bringen will, wird enttäuscht sein von Taschner. Denn begütert werde man heute ohnedies nur entweder durch Erbschaft oder durch Glück. Wieder nicht gerecht.
MICHAELA SEISER.
Rudolf Taschner: Gerechtigkeit siegt - aber nur im Film.
Ecowin Verlag. Salzburg 2011. 226 Seiten. 21,90 Euro
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
© Perlentaucher Medien GmbH