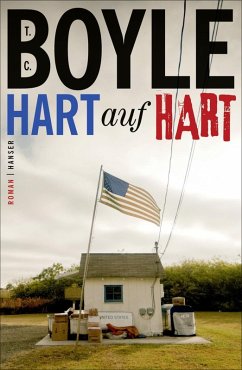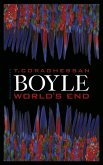Absoluter Freiheitsanspruch und Verfolgungswahn ¿ T. C. Boyle erkundet in seinem neuen Roman die dunkle Seite der USA. Adam, den seine Eltern nach etlichen Schulverweisen und Therapiesitzungen aufgegeben haben, ist eine wandelnde Zeitbombe: In der Wildnis, wo er ein Schlafmohnfeld angelegt hat, führt er ein Einsiedlerleben und hortet Waffen gegen imaginäre Feinde. Aber es gibt jemanden, der sich in ihn verliebt. Sara hat ebenfalls ausreichend Feindbilder: Spießertum, Globalisierung, Verschwörer und die Staatsgewalt. Als sie Adam am Straßenrand aufgabelt, beginnt eine leidenschaftliche Liaison. Doch bald merkt Sara, dass Adam es ernst meint mit den Feinden, sehr ernst.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D, L ausgeliefert werden.
"Ein furioser Roman, der eine Reihe von Fragen stellt und beängstigend nah an der Wirklichkeit liegt." Irene Binal, Neue Zürcher Zeitung 08.07.15 "Ein Pageturner! ... Meisterhaft!" Ursula März, SWR2 Bestenliste, 07.04.15 "Ziemlich große Kunst. ... Ich bin dafür, dass Boyle jetzt bald den Nobelpreis bekommt." Jochen Hieber, SWR2 Bestenliste, 07.04.15 "'Hart auf Hart' ist bedrohlicher Lesestoff. Man weiß, es wird zum Äußersten kommen." Anne-Sophie Balzer, Die Tageszeitung, 11.03.15 "Unbedingt lesen!" Elke Heidenreich, SRF Kultur Literaturclub, 03.03.15 "Ein phantastischer Roman über die Schule der Gewalt, über unsere Zeit, unsere Welt." Volker Weidermann, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 15.02.15 "Ein faszinierendes Portrait amerikanischer Paranoia." Denis Scheck, ARD Druckfrisch, 08.02.15 "Dass der Roman nichts Statisches hat, sondern im Gegenteil eine ungeheure Dynamik entwickelt, liegt daran, dass T.C. Boyle ein süffiger und unterhaltsamer Erzähler ist, der die mentale Gestimmtheit seiner Charaktere in den Alltagsdetails zu verankern weiß und der noch dazu in Dirk van Gunsteren einen ausgezeichneten Übersetzer hat." Christoph Schröder, Süddeutsche Zeitung, 04.02.15 "T.C. Boyle ist kein Freund von Wohlfühlliteratur. Aber man liest seine Geschichten so fasziniert, dass man das Buch nicht weglegen kann. ... Der Roman ist nicht nur eine spannend erzählte Geschichte über eskalierende Gewalt, es ist auch eine Analyse der amerikanischen Gesellschaft, die an den Rändern ausfastert - manchmal mit tödlichen Folgen." Thorsten Heimann, Die Welt, 03.02.15 "Ein beißender Kommentar zur Lage eines tief gespaltenen Landes. In gewohnt rasanter Manier und einfühlsamen Porträts seiner Außenseiterexistenzen zeichnet Boyle ein Psychogramm der in übersteigertem Individualismus verhärteten amerikanischen Seele." Philipp Albers, Deutschlandradio, 03.02.15 "Es ist ein großartiges und beklemmendes Stück Literatur." Burkhard Müller, Die Zeit, 19.02.15

T. C. Boyle, der geniale amerikanische Vielschreiber, erzählt in seinem neuen Roman von einer Welt aus Hass. Und von einem Mann, der sich seinen Weg freischießt. Meint er uns damit?
Die Welt ist nur Gewalt und Hass und Beobachtung und Verfolgung, und es gibt kein Entkommen. Wir leben in einer totalitären Welt, alles wird gescannt, gesammelt, aufbewahrt und kann jederzeit gegen dich verwendet werden. Und wir, Bewohner dieses Planeten unter totalitärer Herrschaft, wir tragen alle Wut in uns. Die meisten arrangieren sich, halten die Wut klein, zähmen sie, lenken sich ab, versenken sich in der Maschine des Alltags, nur um sie nicht zu spüren, jeden Tag. Und auch aus Angst vor den Konsequenzen, die es hätte, wenn man sie freilassen würde, eines Tages, und sei es nur für einen kurzen Moment.
"Die meisten unterdrückten es und zogen hinaus in die Welt", schreibt T. C. Boyle in seinem neuen Roman "Hart auf hart". "Sie wurden Polizisten oder Finanzhaie, gingen auf Lebenszeit zur Armee oder in die Fabrik, aber manche wurden es einfach nicht los, und die landeten dann bald im Gefängnis oder sie hatten einen schweren Motorradunfall und waren fortan Krüppel. Oder tot. Erschossen."
T. C. Boyle, 66, legendärer Chronist, Geschichts- und Geschichtenschreiber der amerikanischen Gegenkultur ("World's End", "Grün ist die Hoffnung") hat einen dieser Typen, einen von denen, die das Ding in sich nicht unterdrücken können, zum Protagonisten seines neuen Romans gemacht. Er heißt Adam, er lebt in den Wäldern Kaliforniens, und eines Tages explodiert er.
Wir nähern uns dieser Explosion sehr behutsam, scheinbar auf Umwegen, Trampelpfaden der Alltagsgewalt oder besser: der erlaubten, der gesellschaftlich anerkannten Gewalt. Ein Rentnerpaar aus Kalifornien ist auf Kreuzfahrt, er, Sten, Vietnam-Veteran, ehemaliger Schuldirektor, durchschnittlicher Rassist, Patriot, sie, Caroleen, seine kampfestreue Ehefrau.
Bei einem Landausflug in Costa Rica wird ihre Reisegruppe von drei Tagedieben überfallen, das Rentnergrüppchen liefert brav Schmuck, Geld und Papier ab. Doch Sten möchte das lieber nicht machen. Mit dem geübten Blick des Veteranen erkennt er das amateurhafte Waffenverhalten der Räuber, schnappt sich den erstbesten, entwaffnet ihn, würgt ihn, bis alle Luft aus ihm entwichen ist. Der Mann ist tot. In Stens Kopf ist alles wieder Vergangenheit, Krieg, Vietnam, ein toter Mensch, alles ist plötzlich anders, nicht wiedergutzumachen.
Im Roman ist das ein erster großer Moment, denn diesem Sten ist durchaus nicht klar, wie die Mitreisenden reagieren werden. Wie später die Polizei des Landes, wie die Gesellschaft reagieren wird. Wann ist die Tötung eines Menschen okay? Für wen? Wer entscheidet, wann Gewalt legitim ist? Und wann eine Heldentat? Er musste diesen Mann nicht töten. Er hatte ihn vorher schon entwaffnet.
Sten ist ein Held. Die Mitreisenden sammeln ihre Wertgegenstände wieder ein und feiern Sten, den guten Killer. Die örtliche Polizei will künftige Kreuzfahrttouristen nicht verschrecken und erklärt den Mord für eine gute Sache. Es war gute Gewalt, das Ergebnis ist gut, nur für den Räuber lief es schlecht. Aber es ist etwas geschehen, etwas Dunkles, Großes. Etwas steckt jetzt drin, in diesem Sten. "Er gehört jetzt nicht mehr zu ihnen. Er war jetzt etwas anderes", schreibt Boyle.
Es wird eine Weile dauern, bis ihn sein Sohn fragen wird, wie es genau gewesen ist, das Morden. Ob dem Opfer beim Würgen die Augen aus den Höhlen traten wie bei einem Frosch, auf den man tritt? Eine total unpassende Frage natürlich. "Darum geht es doch gar nicht", sagt Sten zu seinem Sohn. Geht es nicht? Worum geht es dann, wenn man einen Menschen tötet? Was passiert? Was fühlt man? Was sieht man?
Der Sohn, der ihm die Froschfrage stellt, ist Adam, jener Adam, der wenig später außer Kontrolle geraten wird. Der nicht nur mordet, wenn er angegriffen wird. Sondern auch, wenn er unerwartet angesprochen wird, im Wald, in seinem Wald. Aber: Wann ist ein Angriff ein aggressiver Akt? Wann dürfen wir uns wehren? Wann ist Gewalt erlaubt? Im Krieg? Wann ist Krieg? Wer erklärt den?
T. C. Boyle hat einen phantastischen Roman über die Schule der Gewalt geschrieben. Über unsere Zeit, unsere Welt, in der man immer öfter den Eindruck hat, dass die Menschen, alle Menschen mit ungesicherten Gewehren herumlaufen. Nicht nur in Amerika, dem Land der freien Waffen. Sondern auch hier, in unserer Epoche der großen Gereiztheit, wie es auf dem "Zauberberg" hieß und die groß und immer größer zu werden scheint. In einer Zeit, in der eine falsche Bemerkung ausreichen kann, um einen Konflikt zwischen Ländern oder Menschen eskalieren zu lassen. Es ist etwas in uns. In unserer Zeit.
Also Adam: Schon am ersten Schultag hatte er einen Kameraden verprügelt, einen besonders friedlichen. Warum? Einfach so. Genau weiß er es nicht. Sein Vater, Sten, der Veteran, ist Direktor dieser Schule. Er wird den schwierigen Sohn ein ums andere Mal beruhigen können, die Wut zurückstopfen in den Körperkäfig. Dass es auch die unterdrückte Mordlust und der Hass ist, der in dem Vater schlummert, der in dem Sohn weiterwächst, den er vererbt hat, als einen unterdrückten Kern, eine Bombe, die in seinem Nachkommen explodiert, das beschreibt Boyle unaufdringlich und schrecklich unausweichlich.
Irgendwann wird es in der Schule zu schwierig. Adam kommt in eine sogenannte "Einrichtung", wird mit Medikamenten und Freundlichkeiten ruhiggestellt und bald wieder freigelassen. Die Diagnose: Schwierigkeiten mit der Anpassung ans Erwachsenenleben. In der Tat. Oder, wie es im Roman heißt: "Ja, na klar. Jede Menge. Und dann war er tatsächlich erwachsen gewesen, achtzehn und raus aus der Schule, und da war es dann vorbei mit den Psychoheinis. Stattdessen hatte er Trips genommen, gesoffen, Gras geraucht. Und nun passte er sich also ans Erwachsenenleben an, hier und jetzt."
Ein Mann kommt nicht klar mit der Welt, mit den Regeln der Welt, er versteht sie nicht ganz, setzt Hoffnungen in sein Leben, irgendwelche, kleine, große, falsche. Die Hoffnungen werden enttäuscht. Und was ist dann noch da, an der Stelle der Hoffnungen? Leere? Enttäuschung? Neue Hoffnung?
Irgendwann zieht es Adam in den Wald. Nicht so ein bisschen, wandernd, abenteuernd, sondern richtig in den Wald, die unendlichen alten Redwoodwälder Kaliforniens. Sein Vorbild ist der legendäre Trapper, Entdecker, Waldläufer John Colter. Obwohl er ihn auch ein wenig verachtet, weil er am Ende seines Lebens ein weiches, warmes, bürgerliches Zuhause fand und im Ehebett starb. Ein Kompromissler am Ende. Er, Adam, will zur Legende werden. Kompromisse sind der Feind, die Polizei ist der Feind, Menschen überhaupt sind Feinde. Boyle schreibt immer von einem "Rädchen im Kopf", das sich mal schneller und mal langsamer dreht. Ein kleiner, runder Wahnsinn, der nie stillsteht.
Erstaunlich, dass dieser Adam eine Gefährtin findet, Sara, Hufschmiedin, Hilfslehrerin, auch sie eine Opponentin gegen alles. "Ich habe keinen Vertrag mit euch", ist der Satz, mit dem sie sich gegen regulierungsfreudige Polizisten zu wehren versucht. Die Polizisten sehen das anders. Sie greifen überall zu. Das einst freie Amerika ist in den Augen von Adam und Sara ein durchreguliertes Land. "Die ganze schleimige Hitler-Polizeistaat-Scheiße" nennen sie es. Ein grauenvolles, verrücktes, schmierig heldenhaftes neues Bonnie-und-Clyde-Paar hat Boyle da geschaffen.
Wobei: Paar ist vielleicht doch stark übertrieben. Adam taucht bei ihr auf, tief aus dem Wald, wenn es ihm passt. Er lebt in der dunklen, grünen Gegenwelt, erst in einer Hütte, später in einer Art Bunker, er züchtet Schlafmohn, aus dem er Opium gewinnt, er ist immer auf irgendwelchen Drogen, der Welt entrückt. Im Redwoodwald. Denn dieser Adam ist nicht nur Psychopath, Terrorist, konsequenter Vollstrecker der herrschenden Ideologie unserer Zeit, er ist auch ein Wiedergänger H. D. Thoreaus und dessen "Walden"-Welt.
Wie verhält sich der Mensch, wenn er von allem abgeschieden lebt? Gibt es eine Flucht von allem? Und was erfährt man dort über sich? Ein Experiment, wie es auch Ernst Jünger in seinem Essay "Der Waldgang" zeichnete. Der Einzelne im Wald, umgeben von einem feindlichen Staat, einer totalitären Kraft.
Es sind die stärksten Stellen in Boyles Buch, die Redwoodwelt als Gegenutopie. Für Adam mit dem schnellen Rädchen im Kopf ist hier für kurze Zeit Frieden möglich, inmitten dieser Bäume, manche von ihnen älter als 2000 Jahre. "Er betrachtete die Bäume - vielleicht war er schon einmal an dieser Stelle gewesen, vielleicht auch nicht -, er blieb stehen und sah so lange zu ihnen auf, dass er wieder aus sich heraustrat, so dass das Rädchen sich langsamer drehte und es keine Eile, keine Probleme, keine Paranoia, keinen Kriegszustand mehr gab, sondern nur noch Staunen darüber, dass es sie gab und dass sie tief in die Erde hineinreichten und diese Berge zusammenhielten."
Doch während Thoreau vor mehr als 150 Jahren in den Wäldern von Massachusetts eine Zufriedenheit fand und Weisheit, wächst in Adam mit den Jahren nur der Hass. Vielleicht weil sie ihn nicht allein lassen. Vielleicht, weil Einsamkeit heute selbst in den tiefsten Wäldern nicht mehr möglich ist. Thoreaus Besucher hatten ihn schnell wieder alleingelassen: "Sie fischten offenbar mehr im Waldenteich ihrer eigenen Seele und steckten die Finsternis als Köder an ihre Angeln." Und überließen den Wald schon bald wieder "der Finsternis und mir".
Adam bleibt nicht allein. Die Menschen lassen ihn nicht in Ruhe, das Rädchen dreht sich, die Wut wächst, das Erbe geht auf. "Nur der Tag bricht an, für den wir wach sind", heißt es in "Walden". Mit grauenvoller Konsequenz beschreibt T. C. Boyle einen jungen Mann, der wach ist nur für diesen Tag, für diese Taten. Ein Schuss und noch einer. Bis die Welt gewonnen hat. Und die Bäume, sie sind "die eigentlichen Sieger", schreibt Boyle über eine Welt, aus der es kein Entkommen gibt.
VOLKER WEIDERMANN
T. C. Boyle: "Hart auf hart". Übersetzt von Dirk van Gunsteren. Hanser, 400 Seiten, 22,90 Euro
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main