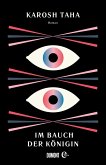Der Autor Michael Lentz bedauert, dass sein Vater früher wenig von seiner Kindheit erzählt hat. In seinem Roman „Heimwärts“ widmet er sich den eigenen Erinnerungen an die Zeit im Elternhaus in der rheinischen Kleinstadt Düren. Seit vielen Jahren lebt er in Berlin und erzählt inzwischen auch seinem
Sohn von seinen jungen Jahren.
Der Vater des Autors saß der Stadtverwaltung vor und war dadurch eine…mehrDer Autor Michael Lentz bedauert, dass sein Vater früher wenig von seiner Kindheit erzählt hat. In seinem Roman „Heimwärts“ widmet er sich den eigenen Erinnerungen an die Zeit im Elternhaus in der rheinischen Kleinstadt Düren. Seit vielen Jahren lebt er in Berlin und erzählt inzwischen auch seinem Sohn von seinen jungen Jahren.
Der Vater des Autors saß der Stadtverwaltung vor und war dadurch eine öffentliche Person. Manches Mal gelang es ihm nicht, seinen Beruf an der Haustür abzustreifen. Er war streng und zur Durchsetzung seines Willens kam es vor, dass er seinen Sohn zügelte, ohne dass seine Frau eingriff. Die Mutter des Autors nahm die klassische Hausfrauenrolle ein, mit der sie, nach Meinung ihres Sohns, nicht zufrieden war.
Doch nicht die Eltern von Michael Lentz stehen in seinem Roman im Mittelpunkt, sondern das Verhalten des Autors als Kind und wie seine Eltern darauf reagiert haben. Es ist eine lose Sammlung von Gedanken, die er in Kapitel zusammenfasst, welche er mit jeweils einem Wort betitelt. Er erinnert sich beispielsweise an die Truhe im Flur des Elternhauses, ans Lernen, eine Spieluhr, seine Ferien und Osterfeste.
Michael Lentz beschreibt feinsinnig nicht nur die Situationen, die ihm in den Sinn kommen, sondern auch, was ihn darin innerlich bewegte und warum er wie handelte. Er lässt den Lesenden tief in seine reiche Vorstellungswelt als Kind schauen und erzählt von seinen Ängsten, seinen Problemen, seinen Träumen und Wunschvorstellungen. Immer wieder versinkt er in seinen eigenen Kosmos, der ihn bis heute begleitet und einzigartige Basis für seine Texte ist. Der Autor gibt zu bedenken, dass er seine Erinnerungen aus heutiger Sicht wiedergibt und damals auch aus anderen Gründen motiviert gewesen sein könnte.
Immer wieder wechselt er unvermittelt die Perspektive und gibt seinem Sohn Worte ein, die dieser über die eigenen Kindheitstage der letzten Jahre erzählt. Es zeigt sich, dass er sich als Vater so verhält, wie er es sich von seinen Eltern für sich gewünscht hätte. Die Übergänge zwischen den Ansichten sind fließend und werden meist mit einem Verweis auf die inzwischen vergangenen Jahre angekündigt. Manchmal bemerkte ich allerdings die Veränderung erst nach mehreren Sätzen. Der Vergleich der Welt eines Kinds von heute und gestern fand ich interessant, denn die jeweiligen Eigenheiten in der Erziehung sind zu erkennen.
Da ich im gleichen Alter wie der Autor bin, habe ich mich gerne gemeinsam mit ihm zurückerinnert. Weil meine Heimatstadt nur 50 km westlich von Düren liegt und ich die Örtlichkeiten kenne, bin ich die Wege mitgegangen und habe mich ebenfalls am Erkennen der mir bekannten regionaler Besonderheiten erfreut, wie zum Beispiel die Sprichworte der Mutter oder die erwähnten Speisen.
Im Roman „Heimwärts“ denkt Michael Lentz an seine Kindheit zurück und nimmt den Lesenden mit zu seinen Erinnerungen an ein Alltagsleben zwischen der Öffentlichkeit des Vaters, der Heimat schaffenden Mutter, dem Verankert sein zwischen den Geschwistern und seinem reichen Innenleben mit Furcht, Respekt und Erlebnishunger. Er findet durch seinen Sohn den Vergleich mit der Gegenwart. Gerne bin ich ihm in die Vergangenheit gefolgt und empfehle das Buch weiter.