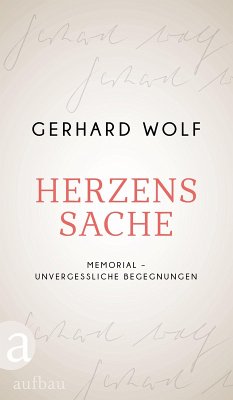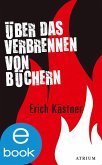"Ein Genie der Gemeinsamkeit" Volker Braun. "Wer ist Gerhard Wolf? Der wagemutige Verleger, eindringliche Essayist, exzellente Lektor, kunstversessene Herausgeber? Der Meisterkoch der deutschen Gegenwartsliteratur? Der Mann einer berühmten Frau, der Schriftstellerin Christa Wolf? Sollte all dies in einer einzigen Person vereinigt sein?" Friedrich Dieckmann. Wenn dieser Gerhard Wolf seinen Passionen folgt und über Begegnungen mit unvergesslichen Literatur- und Malerfreunden schreibt, entstehen lebendige Künstlerporträts, die zum Lesen und Entdecken verführen: Irmtraud Morgner, Walter Jens, Günter de Bruyn, otl aicher, Carola Stern, Heinz Zöger, Stephan Hermlin, Tadeusz Rózewicz, Günter Grass, Bert Papenfuß, Stefan Heym, Andreas Reimann, Johannes Bobrowski, Carlfriedrich Claus, Christa Cremer, Volker Braun, Gino Hahnemann, Jan Faktor, Louis Fürnberg, Nuria Quevedo, Maria Sommer, Barbara Beisinghoff, Róza DomaScyna, Angela Hampel, Franci Faktorová, Brigitte Reimann u. a. "Ich kann nur über mich schreiben, indem ich über andere schreibe." Gerhard Wolf
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.