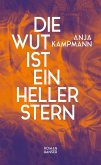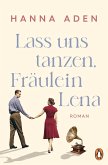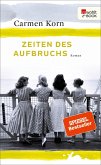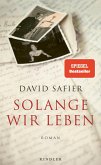Die Herberge der verlorenen Herzen
Obwohl ich noch nie ein Buch von Carmen Korn gelesen habe, griff ich nach dem Lesen des Klappentextes sofort zu. Ich habe die unmittelbare Nachkriegszeit nicht erlebt, bin geboren, als das Schlimmste überstanden war in den deutschen zerbombten Großstädten, aber
ich habe noch Ruinen, Lebensmittelmarken und Mangel kennengelernt. (gekürzt)
Die Geschichte, die…mehrDie Herberge der verlorenen Herzen
Obwohl ich noch nie ein Buch von Carmen Korn gelesen habe, griff ich nach dem Lesen des Klappentextes sofort zu. Ich habe die unmittelbare Nachkriegszeit nicht erlebt, bin geboren, als das Schlimmste überstanden war in den deutschen zerbombten Großstädten, aber ich habe noch Ruinen, Lebensmittelmarken und Mangel kennengelernt. (gekürzt)
Die Geschichte, die Protagonisten, deren Lebenswege haben mich sehr bewegt. Hamburg, in dessen Speckgürtel ich lebe, ist mir ein wenig nähergekommen, manches betrachte ich beim nächsten Besuch vielleicht mit anderen Augen. Carmen Korn hat ein lebendiges, authentisches Kaleidoskop erschaffen, mit ihrem Roman schaut man als Leser in die Abgründe, die der Nationalsozialismus und der Zweite Weltkrieg hinterlassen haben. Bombentrichter in den Städten und in den Seelen der Deutschen, die Täter und Opfer, Mitläufer oder Wegschauer waren. „Wir sind noch einmal davongekommen.“, hört man allenthalben.
Carmen Korn stellt uns, den Lesern, einige dieser Deutschen vor: im Mittelpunkt des Romangeschehens steht Friede Wahrlich, die ehemalige Volksschauspielerin, die zu Kriegsende kaum mehr besitzt als ihr halbzerbombtes Haus, die nicht verbrannten Wintersachen und ein sehr schlechtes Gewissen. Ihr Leben vor dem Hamburger Feuersturm war gut und manchmal etwas ausschweifend, sie hatte Chancen bei den Männern, allen voran Viktor Franke, der jüdische Theaterkritiker, aber auch Palutke, der sich vom Rivalen auf schäbige Weise befreite. Friede wähnt Franke unter den Ermordeten des Ghettos Litzmannstadt. Den Palutke gibt es auch nach Kriegsende noch, einer von denen, der immer auf die Füße fällt. Nur bei Friede kann er nicht mehr landen. Dafür landen bei ihr andere, der 16-jährige Gert, Kriegsteilnehmer der letzten Stunde, nun Kriegswaise und obdachlos. Er kann bei Friede im Keller wohnen, in den ihm nach einem halben Jahr das Mädchen Gisela durchs Fenster hereinfällt. Und bleibt. Wie hart diese ersten Nachkriegsjahre, besonders die Winter, waren, erfährt man hier bei Carmen Korn sehr eindrücklich. Immer wieder frage ich mich, wie würde ich das heute aushalten? Würde ich das überhaupt aushalten? Heutige Berichte über Frauen und Kinder in der bombardierten Ukraine stehen mir vor Augen. Woher kommt immer wieder die Hoffnung, damals wie heute?
Zu Friedes Kreis gehörte und gehört auch Marta, noch nicht ganz 60, also ein paar Jahre jünger als Friede, aber ausgebufft genug, sind bei dieser immer wieder lieb Kind zu machen, sie ist vom „Stamme Nimm“, wie Friede passend sagt. Und sät Zwietracht, wo es nur geht. Zwischenzeitlich bewohnt Marta dann eines der, man glaubt es kaum, im oberen Stock von Friedes Haus neu hergerichteten Zimmer. Ein Künstlerpension sollte es werden, aber es wird eher ein Mehrgenerationenhaus, wie man das heute nennen würde, und die Herz- und Schmerzgeschichten der Bewohner können einen tatsächlich zu Tränen rühren.
Gisela und Gert, die mittlerweile von Freunden zum Liebespaar geworden sind, finden Arbeit und es geht ein bisschen aufwärts. Wenn da nicht die schwelenden Gedanken um das Schicksal der Angehörigen wäre. Dass die Mütter der beiden tot sind, damit finden sie sich ab, aber Gisela sucht ihren Vater, der als Fotograf einer Propagandakompanie an der Front war und Gert hofft noch immer darauf, seine kleine Schwester wiederzufinden. Gisela arbeitet für einen Professor Nast, recherchiert für dessen neues Buch und dieser erweist sich als ein neuer guter Freund der beiden. Dass er sich zufällig auch mit Viktor Franke befreundet, bringt eine besondere Ebene ins Geschehen.
Viktor Franke wiederum hat eine rothaarige Freundin, Marianne, die jahrelang fern von Hamburg an den Münchener Kammerspielen schauspielert. Sie ist nach Friede sein neues „Leitlicht“, aber er wird lange brauchen, um sein angeschlagenes Selbstbewusstsein dieser Frau entgegenstellen zu können. Nast ist ihm auch dabei eine moralische Stütze.
(gekürzt)
Die Detailgenauigkeit und die emphatische Charakterisierung jedes Protagonisten haben dazu beigetragen, dass ich zeitweise völlig aus meinem wohl behüteten Alltag hinauskatapultiert wurde, mit Gert und Gisela im Keller stand oder am Familienküchentisch bei Frieda saß. Jeder findet ja beim Lesen auch eine Lieblingsfigur, deren Schicksal besonders nahe geht. Für mich ist das Victor Franke, der entrechtete und deportierte Jude, totgeglaubt, in den Gedanken von Friede aber immer wieder auftauchend. Dass er sich nach dem Krieg in Hamburg doch wieder einlebte, arbeitete, verliebt war, nie rachsüchtig, nie auftrumpfend, manchmal melancholisch, fast depressiv, immer am Ende standhaft, das hat mir sehr gefallen.
Fazit: Dieses Buch empfehle ich gern weiter, es liest sich gut, auch wenn es sich vielleicht nicht zur hohen Literatur aufschwingt und keine „Gespräche wie die von Naphta und Settembrini“ (Zitat) hervorbringt, so hat es mich doch von der ersten bis zur letzten Seite begeistert und tief berührt.