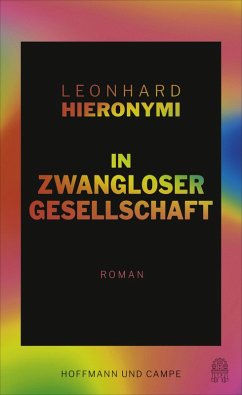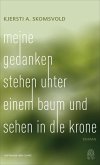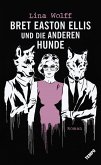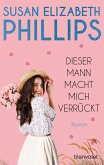»Einerseits wäre ich gerne tot, damit Leonhard Hieronymi meine letzte Ruhestätte beschreiben könnte - andererseits könnte ich das dann leider nicht mehr lesen.« Hans Zippert, Titanic Nach einem Lachanfall in den Katakomben von Rom, der doch irgendeinen Grund gehabt haben muss, macht sich ein junger Mann auf den Weg: Durch Ohlsdorf, Constanta, Wien und Prag, entlang der Grabsteine Europas größter und kleinster Literaten beginnt er eine Spurensuche - nach den unheimlich Verschwundenen und den Unsterblichen. Häufiger als erhofft stößt er dabei auf knutschende Paare, Bonbonpapier, Champagnerflaschen und dann doch keine Mentholzigaretten; trifft Orgelsachverständige, Totengräber und Hermann Hesses Enkel, und es braucht neben Durchhaltevermögen nicht zuletzt Rotwein, eine Arminius-Schreckschusspistole und eine frisierte Vespa, bis er erstaunt zu dem Schluss kommt: Verschwinden ist Luxus. Ein wildes, phänomenales Debüt, das uns berauscht, beglückt und amüsiert und ganz nebenbei ein völlig neues Licht auf das Europa unserer Tage wirft.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.