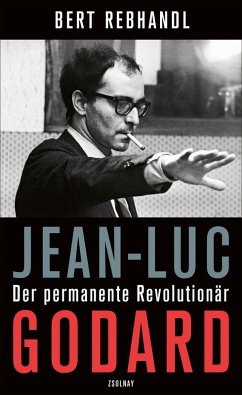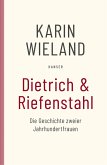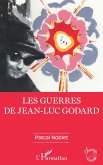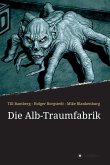"Ich bin eine Legende!", sagt Jean-Luc Godard - Bert Rebhandls Gesamtdarstellung über den Revolutionär des Kinos. Am 9. Dezember feiert Godard, Regisseur von Außer Atem, seinen 90. Geburtstag. 1960 war er der größte Popstar des Kinos: "Außer Atem" (mit Jean Seberg und Jean-Paul Belmondo) feierte Premiere; im Jahr darauf war seine Hochzeit mit Anna Karina auf den Titelseiten der Illustrierten; seine Filme zogen Hipster aller Art an, als diesen Begriff noch kaum jemand kannte. Dann kam 1968, und für Jean-Luc Godard begann ein Prozess der permanenten Revolution des Kinos, der bis in die Gegenwart für Aufsehen und Debatten sorgt. Er ist ein Intellektueller vom Rang eines Jean-Paul Sartre, indem er die Bilder zum Denken bringt. In diesem Buch wird zum ersten Mal in deutscher Sprache Godards aufregendes Leben mit seinem filmischen Werk zusammen erzählt. Eine einzigartige europäische Figur in einer lange überfälligen Gesamtdarstellung.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D, L ausgeliefert werden.
"Eine wunderbar faktensatte neue Godard-Biografie ... Die besten seiner Filme möchte man sich sofort noch mal ansehen, wenn man Rebhandls souverän erzähltes und mit vornehmer Zurückhaltung analysierendes Buch über den Filmemacher liest." Wolfgang Höbel, Spiegel Online, 07.12.20 "Ein wunderbarer, dichter Teppich der cineastischen Kenntnis, nicht ohne Muster des persönlichen Enthusiasmus, auf dem man sich einigermaßen sicher in die Werkräume eines Kerls begeben kann, der seine Gäste nicht gerade mit offenen Armen zu empfangen pflegt." Georg Seeßlen, epd Film, 02.12.20 "Rebhandls Abhandlung bietet sich als Einstiegslektüre an, liefert aber auch genügend Seitenpfade für Godard-Kenner ... Keine geringe Leistung, zumal Rebhandl auf nur 280 Seiten unglaublich dicht analysiert. Solange sich Godard erfolgreich der Musealisierung entzieht, bleiben uns zum Verständnis dieses einzigartigen Werks vermutlich weiterhin nur Bücher wie dieses und seine Filme." Andreas Busche, Tagesspiegel, 16.12.20 "Rebhandl ist hier zweifellos ein großer Wurf gelungen." Walter Gasperi, Die Furche, 07.01.21 "Sehr kompetent, sehr kompakt geschrieben, eine richtig gute Biografie zum 90. Geburtstag." Mario Scalla, hr2, 03.12.20 "Rebhandls luzide verfasste Monografie bietet einen perfekten Einstieg in die komplexe Geistes- und Kinowelt Godards." Stefan Grissemann, Profil, 22.11.20 "Eine anregende und wohltuend subjektive Biografie" Rüdiger Suchsland, Schwäbische Zeitung, 03.12.20 "...fast 50 Langfilme und zahlreiche 'Nebenwerke' in ein handliches Buch zusammenzufassen ist eine Herausforderung, geht in diesem Fall aber voll auf. Bert Rebhandl zieht einen roten Faden durch die Bild- und Wortmassen des universalen, widersprüchlichen, aber durch seinen unverwechselbaren Ton authentischen Konstrukteurs eines Gesamtkunstwerks, das mehr als Bild und Ton sein will." Thomas Leitner, Falter, 28.10.20 "Kenntnis- und detailreich beschreibt Rebhandl Godards Vorliebe für das Paradox, seinen Widerspruchsgeist und seine Lust, sich mit Mitwirkenden, Kritikern, Produzenten und dem Publikum anzulegen." Wilfried Reichart, Der Standard, 16.11.20 "Bert Rebhandl gelingt das Kunststück, Godards Denken in Bildern und Tönen zurück in die Sprache zu holen. Lesend kommt man dem so unnahbaren Kinoschamanen gespenstisch nahe." Joachim Leitner, Tiroler Tageszeitung, 16.11.20