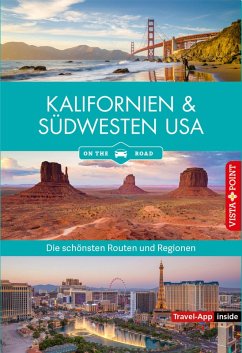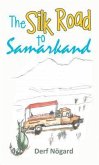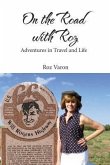EINLEITUNG REISEN MIT SIEBENMEILENSTIEFELN Kein Landstrich Nordamerikas hat sich in den Köpfen so bilderreich eingenistet wie der amerikanische Südwesten, Kalifornien eingeschlossen. Und was die Fantasie anregt, weckt zumeist auch die Neugier, den Bildern nachzureisen, um sie auf die Probe zu stellen. Stimmen sie oder sind sie nur schöne Kulissen für prahlerische Reiseberichte? Die Antworten fielen und fallen sehr unterschiedlich aus. Aber wie auch immer: Es hat wohl selten Reisende durch die Wüsten, Gebirge und Gewässer des südlichen Westens gegeben, die nicht von den grandiosen Naturlandschaften beeindruckt gewesen wären. Die traumhafte Pazifikküste, die urtümlichen Canyons und Steinkathedralen des Colorado Plateau, der weite offene Horizont und die betörenden Lichtspiele des Himmels tagsüber und nachts - das allein schon ist eine Reise wert. Erst auf den zweiten Blick mag diese überwältigende Szenerie ihre Schattenseiten zeigen: eben das »Wilde« im »Westen«, seine elementaren Naturkräfte, seine gnadenlose Sonne, seine Menschenfeindlichkeit. Kakteen in kargem Geröll, so fotogen sie sich geben, sind nun mal kein Kurpark oder Stadtwald; Wassermangel, Hitze, Moskitos und Klapperschlangen lassen sich durch keinen Vers von Eichendorff romantisch verklären. Widersprüche lauern auch anderswo. So wurden einige dieser unberührten Weiten des Westens per Gesetz zu Nationalparks erklärt, um sie vor ihrer Vernichtung durch Raubbau oder sonstiger »Erschließung« zu schützen. Das war nicht einfach. Früher wurden die wirtschaftlichen Interessen der Holz-, Erz-, Gas- oder Ölfirmen sogar noch rabiater vertreten als heute. Dennoch: Jede Reise durch den Südwestteil des Kontinents führt durch umkämpfte Zonen geschützter und bedrohter Natur. Die Stichworte heißen: Austrocknung des Mono Lake, Wasserorgien in Las Vegas, Uran in Utah, Ölförderung an der Pazifikküste. Ja, auch der Tourismus gerät ins Zwielicht, wenn der Massenandrang die löbliche Naturschutzabsicht ins Gegenteil verkehrt. In einer Zeit, da sich die Menschen zur Hauptsaison im Yosemite-Nationalpark oder am Grand Canyon häufig »auf den Füßen stehen«, gewinnen abgelegenere Gebiete wie die Wildlife Refuges und Wilderness Areas an Bedeutung, sind sie doch genauso schön, aber weniger überlaufen. Wie das »Wilde« zehrt stets auch das »Gezähmte« von den Traditionen des Westens, denn trotz harter Steinpanoramen und garstiger Salzwüsten gab es hier Oasen der Entspannung und des Wohllebens - an den zahlreichen heißen Quellen erfreute sich schon die indigene Bevölkerung. Heute kann es ihr jeder in den üppigen Badelandschaften, den Pools und Spas, den Fit- und Wellnesscentern der Resorts gleichtun oder die Rituale der kalifornischen Körperkultur mitmachen. Diese bedient sich der Trainingsmaschinen in Venice Beach und der Surfbretter von Malibu ebenso wie der Mountainbikes und Kajaks in Moab (Utah), dem neuen Zentrum der Outdoor-Sportindustrie, die auch mit schwerem Gerät fürs Wochenende ausrüstet. Paradoxerweise erinnert dieser Freizeittrend ebenso an das Cowboy-Ideal von der Unabhängigkeit wie an die NASA-Astronauten, die cosmic cowboys: glänzende Ritter im Cockpit statt im Sattel. Faszination mit Widersprüchen Doch weder Canyonwände noch Chilischoten oder Lasso werfende vaqueros machen allein und für sich den Südwesten aus. Sein innerer Zusammenhalt lebt von den Mythen - angefangen bei den frühesten Reiseberichten über Buffalo Bill und andere Schausteller bis hin zum urban cowboy, der in den Designerläden zur Kopie angeboten wird - von schmauchenden Friedenspfeifen bis zur »Marlboro Light«, von Karl May bis Peter Fonda, der auch schon mal Touristen auf Easy-Rider-Spuren betreute. Kurz, hinter jeder Felsnase oder Flusskrümmung, jedem Tumbleweed-Busch und jeder schwingenden Saloon-Tür lauern die alten Akteure, die bösen wie die guten. Der Wilde Westen, Ausgabe Süd: ein Patchwork bunter Legenden. Zuerst überwogen solche von verborgenen Schätzen, Geistern, Liebhabern und Frauen, die unversehens und verführerisch in der Einöde auftauchten. Danach folgten die Geschichten von den gunmen und lawmen: Mit der Glorifizierung der Schießerei ging die Romantik des Old West in dessen Eroberung und gewaltsame Annexion über. Die Geschichte des inneramerikanischen Tourismus belegt, dass die Mythenfülle schon früh reisemagnetische Wirkung hatte. Eisenbahngesellschaften und Zitrusfarmen lockten neue Siedler und Besucher an. Weinende indigene Kleinkinder auf kolorierten Postkarten animierten zum Ruinen-Tourismus der Pueblos und der indigenen Felsbauten. Reiche Ostküstler leisteten sich Ranchurlaube und Jagdtrips mit indigenen Scouts. Tourismusfördernd erwiesen sich auch literarische Produkte viktorianischer Fantasie im Osten der USA und in Europa, die in Hymnen die freie Liebe im freien Leben in der Wildnis feierten - reichlich unbegründet und auch vom Timing daneben, denn die Open Range war längst eingezäunt oder hatte respektablen Kleinstädten Platz gemacht. Zu den frühen Kolporteuren des Westens gehörte übrigens der bereits von Theodor Fontane rezensierte, aber erst vor einigen Jahren wieder entdeckte Balduin Möllhausen. Der gebürtige Bonner und seines Zeichens Fallensteller, Hobby-Ethnologe, Topograph, Erzähler und Aquarellzeichner reiste um die Mitte des vorigen Jahrhunderts im Kundschaftertross der Eisenbahngesellschaft United States Pacific Railroad Expedition & Surveys durch den Südwesten und skizzierte unterwegs vor allem Landschaften und die indigene Bevölkerung. Was Literatur, Aquarellkunst und Druckgrafik vorbereiteten, Wildwest-Shows und Cowboyheftchen popularisierten fand dann schließlich in Hollywood sein Imprint auf Zelluloid. Seit Anfang des Jahrhunderts machten unzählige Westernfilme und TV-Serien Colt und Tomahawk, Sagebrush und Chaparral zum festen Inventar der schönen Westernwelt. Doch genau diese mythischen Grundlagen werden in jüngster Zeit stärker denn je angezweifelt. So scheint es zum Beispiel mit der Devise »jeder sei stets seines Glückes Schmied« und dem Mythos vom hartgesottenen Einzelgänger (rugged individualist) à la John Wayne ebenso wenig weit her gewesen zu sein wie mit der Vorstellung vom ganz und gar unabhängigen frontiersman. Vieles spricht dafür, dass die angeblich allein auf sich gestellten Siedler meistens gejammert und bei der Bundesregierung um Unterstützung gebettelt haben. Von der Mutterbrust staatlicher Subventionen zu leben (nursing on the government's nipple) war ihnen eigentlich das Liebste, wenn es um Flussbegradigungen, den Bau von Eisenbahnen, Forts (der Überfälle wegen) oder Staudämmen (für die Bewässerung) ging. Auch die Rolle der Pionierfrauen sieht man langsam anders. Seit eh und je figurierten in der Machowelt der Cowboys Frauen meist nur als Kontrapunkte: entweder heroisch stilisiert als pioneer mothers der Trecks oder eben schlampig angezogen, unfrisiert und stets zu haben. Kein Wort dagegen von den starken Naturen der Cowgirls oder jenen berufserfahrenen Frauen (Journalistinnen, Geschäftsfrauen), die in großer Zahl allein in den Westen kamen, um dort als Ärztinnen, Anwältinnen, ja selbst im Bürgerkrieg »ihren Mann« zu stehen. Sie entsprachen in keiner Weise dem Typ, mit dem gut Kirschen essen war. Im Gegenteil. Sie repräsentierten, was man die frontier femininity nannte, eine couragierte Weiblichkeit, der es in erster Linie darum ging, das gemeinsame Überleben zu sichern. Ethnische Vielfalt auch bei Westernhelden Von Ausnahmen abgesehen bevölkern meist nur Anglos das Pantheon der Western-Heroen: Sheriffs, Trapper, Siedlungsführer und jede Menge Kavallerieoffiziere. Eine unter dem Motto »Legends of the West« erschienene Briefmarkenserie bestätigt diese ethnisch völlig unausgewogene Ausrichtung. Zwar sind unter den 20 ausgewählten Ikonen drei Indigene (American Indians) und zwei Schwarze (African Americans) abgebildet, aber kein einziger Hispanic. Prompt protestierten die Mexicanos. Mindestens drei der ihren hätten unter den führenden Köpfen auf den 29-Cent-Marken auftauchen müssen: Pio Pico, der letzte mexikanische Gouverneur von Alta California, Joaquin Murrieta, der während der Gold-Rush-Ära mexikanische Arbeiter gegen rassistische Yankees in Schutz nahm und sich den Beinamen eines kalifornischen Robin Hood erwarb, und der mexikanische General Mariano Guadalupe Vallejo, der die russischen Siedlungsabsichten in Nordkalifornien stoppte und sich später für die Staatsgründung einsetzte. »Es gab eine Menge bedeutender Californios, Mexicanos, Texanos und spanischer Legenden, die im Westen heimisch waren, bevor die Yankees kamen«, schrieb der mexikanische Autor José Antonio Burciaga (1940-96) in der »Los Angeles Times«. Schließlich habe der gesamte Südwesten einmal Mexiko gehört und auch nach 1848 hätten die Mexikaner das Land nicht verlassen, sondern hätten sich vermehrt und Englisch gelernt: »Wir haben nie die Grenze überquert, sie hat uns überquert.« Das Problem der illegalen Einwanderer am »Tortilla-Vorhang« hat sich in letzter Zeit weiter verschärft und in Kalifornien zu einer regelrechten Anti-Einwanderungshysterie geführt. Die nordamerikanische Freihandelsorganisation NAFTA, von der man sich unter anderem eine Ausdünnung des Immigrantenstroms versprach, hat diese Erwartung bisher nicht erfüllt. Der schwache Peso verzögert die Lösung der Grenzkonflikte. Seit 1999 bilden in Kalifornien die Minderheiten die Mehrheit - Majority-Minority-State - dasselbe passiert im Südwesten. Wie den »Großkopferten« erging es den Sagen vom einfachen Cowboy. Auch hier sind neue Fakten zutage gefördert worden, unter anderem der Sachverhalt, dass unter den ersten Cowboys nicht nur Schwarze, Araber, Basken, Tataren und Kosaken waren, sondern auch viele Juden. Immerhin: Im Jahr 1545 war ein Viertel der spanischen Bevölkerung von Mexico City jüdisch und noch rund hundert Jahre später, 1650, gab es mehr als ein Dutzend Synagogen in der Stadt. Verfolgt von der spanischen Inquisition kamen die jüdischen Konquistadoren zunächst mit Cortez nach Mexiko, was zwar nicht verhinderte, dass man selbst dort einige von ihnen aufspürte und verbrannte, aber den meisten gelang es, sich als Vieh- und Pferdezüchter niederzulassen, gewissermaßen im stillen Versteck der Ranch, im Exil. Man tolerierte sie, denn auf der Suche nach den sagenhaften Schätzen war Fleisch ein begehrtes Nahrungsmittel. Später, als die Inquisition von Spanien nach Mexiko vordrang, zogen die jüdischen Pioniere der Viehzucht in den heutigen amerikanischen Südwesten und brachten dabei außer Lasso und Westernsattel auch die andalusischen Vorfahren der heutigen quarter horses mit. Dennoch, ihre enge Verbundenheit mit der Gründungsgeschichte des Westens konnte nicht verhindern, dass sie fast völlig in Vergessenheit gerieten. Nur einem wandernden Juden aus Bayern erging es besser: Levi Strauss, der, nachdem er seines Kolonialwarenladens in San Francisco überdrüssig geworden war, den Cowboys die richtigen Hosen verpasste. Er selbst mied das Wort »Jeans« und warb lieber mit dem kämpferischen Slogan »Pants that won the West«. Tatsächlich stiegen die Jeans zum Outfit des Westerners schlechthin auf, zum Symbol seiner vorgeblichen Unabhängig- und Furchtlosigkeit, lange bevor sie Marlon Brando und James Dean im Film popularisierten. Ähnlich trüb ist auch die Erinnerung an die Chinesen. Keiner der rund 13¿000 »Kulis«, die die westliche Hälfte des eisernen Trails der transkontinentalen Eisenbahn bauten, erschien jemals auf den Jubelfotos von 1869, als die Strecke vollendet wurde. Und genauso ruhmlos blieb ihre Arbeit in der aufstrebenden kalifornischen Weinindustrie. Sie wurden stets belächelt, verachtet und verfolgt. Noch heute ist die ethnische Komposition in Kalifornien und dem Südwesten voller Kontraste. Keineswegs sind die Beziehungen zwischen den Bevölkerungsgruppen so pittoresk, wie es Fiestas, Folklore und andere ethnische Festivals suggerieren. Schon gar nicht in den großen Städten. Das gilt für den traditionellen Mix aus indigener Bevölkerung, Hispaniern und Anglos ebenso wie für die Schwarzen-Ghettos und die südostasiatischen Enklaven der Westküste zwischen Oakland und Koreatown in L.A. Indigenes Erbe reloaded Einzelne ländliche Regionen dagegen verzeichnen bemerkenswert friedlichere Formen des Zusammenlebens, der Südosten Arizonas etwa, der Süden von Colorado oder das nördliche New Mexico. Andernorts führen wirtschaftliche Fragen zu neuen Spannungen - wie beim Kampf der indigenen Völker um die Nutzung der Energiequellen in ihren Reservaten, um Kohle, Erdgas, Öl und Uran. Am auffälligsten tritt das bei den Navajo zutage, die als Navajo Nation in der sogenannten Four Corners Region (Utah, Colorado, New Mexico und Arizona) als Halbnomaden auf einer Fläche leben, die größer ist als Belgien. Sie befürchten, dass die von der Bundesregierung garantierten Verträge, die sie gegen auswärtige Erschließungsfirmen absichern, gekündigt werden könnten. Andererseits wirken einzelne Stämme und Pueblos bei der Erschließung von Bodenschätzen, der Vermarktung von Erholungsgebieten oder beim Thema »Glücksspiel« durchaus findig. In den Reservaten am oberen Rio Grande oder in denen der Agua-Caliente in Palm Springs nutzen Native Americans seit Jahren ihre Chance, am Spielfieber des weißen Mannes kräftig mitzuverdienen. Schließlich ist auf ihrem Grund und Boden alles erlaubt, was nicht gegen Bundesgesetze (federal law) verstößt. Den Kasinobetrieb verbieten aber lediglich die Staatsgesetze (state law) - Nevada, New Jersey und Mississippi ausgenommen. Früher und Heute unterhalten im Südwesten auch sonst verschlungene Beziehungen bzw. mehr oder weniger offenkundige Parallelen. Selbst beim Thema Lifestyle. Hier hat natürlich Kalifornien die Nase vorn. Trotz Erdbeben und Erdrutsch geschüttelter und sozial unruhiger Zeitläufe, die zunehmend auch überzeugte Kalifornier nervös machen, erweist sich Los Angeles immer noch als Garküche der Lebensstile und Moden, als ein Experimentierfeld der Gurus, Gags und Gimmicks. Das Ausgeflippte, das vordergründig in denkbar scharfem Kontrast zum kargen und geradlinigen Siedler-Image steht, hat dennoch seine Voraussetzungen in der traditionell westwärts orientierten Suche nach Freiheit - auch von den Bindungen, Rücksichten und Konventionen des Ostens. Kontrast und Verwandtschaft gleichermaßen durchwirken selbst die religiös-spirituellen Obertöne in den Weiten des Westens. Der spanische Katholizismus der alten Dorfkirchen und Missionen verträgt sich mit indigenen Riten in den unterirdischen Kivas der Pueblos, während das Arbeitsethos der Mormonen in Utah meilenweit von Okkultismus und New-Age-Schwingungen in Santa Fe oder Sedona entfernt ist. Der Hang zur Freiheit (und sei es auch nur zu der von den kalten Wintern des Nordostens) sorgt auch für die Allgegenwart der Senioren im sonnigen Südwesten. Süd-Arizona und Südkalifornien genießen den Ruf von Pensionistenparadiesen. Viele nutzen sie auf Dauer, andere auf Zeit: wie die snowbirds aus dem kalten Norden. Angesichts der unzähligen RVs (recreational vehicles) und Camper auf den Superhighways drängt sich das Bild der alten Prärieschoner und Planwagen auf, die auf den Trails nach Westen zogen. Markante Architektur Auch baugeschichtlich bietet der Südwesten überraschende Reprisen. Die Entwicklung reicht von den Höhlen-, Klippen- und Pueblo-Bauten der Anasazi (Mesa Verde, Montezuma, Chaco Canyon oder die noch bewohnten Dörfer der indigenen Bevölkerung am oberen Rio Grande und in Acoma) über die Missionskirchen, die die spanischen Konquistadoren in Kalifornien, am Rio Grande und Green River errichten ließen, über die falschen Fassaden der Anglos in den frühen railroad towns und mining camps - der verstorbenen (z.¿B. Bodie) oder wieder belebten (Bisbee, Madrid) - bis zu den post- und hypermodernen Konstruktionen in den Metropolen Los Angeles, Phoenix, San Francisco, San Diego, Tucson und den spektakulären Fantasy-Hotels in Las Vegas. Manchmal aber verstecken sich die Überraschungen in Kleinigkeiten, die plötzlich mehr enthüllen, als man meint. Irgendwo liegen da unscheinbare Steine als Geröll am Berghang, die aber unter einer bestimmten Lichteinwirkung alte indigene Felszeichnungen erkennen lassen. Und zuweilen tut sich ein richtiges kleines Museum zwischen Felsbrocken auf, die ansonsten belanglos herumliegen. Bei vielen Ruinen im Lande passiert manchmal Ähnliches. Vom fahrenden Auto übersieht man sie häufig, so sehr sind ihre Farben und Umrisse mit der Umgebung identisch. Selbst die meisten bewohnten Häuser (hogans, Adobe-Bauten) unterscheiden sich kaum von der Erde, auf der sie stehen und die zugleich der Stoff ist, aus dem sie gebaut sind. Wo das eine aufhört und das andere beginnt, ist oft schwer auszumachen, erst recht bei den Tieren. Gut getarnt sind sie alle. Das reizt zum Entziffern, zum Abenteuer des Entdeckens. Aus kleinen Anzeichen die richtigen Schlüsse zu ziehen und sie sinnvoll einzuordnen, das ist eine Kunst, die man unterwegs lernen kann, eine Fähigkeit, die an die indigene Bevölkerung erinnert und die sie hier von jeher praktiziert. Ein Angloamerikaner erzählte von seinem Erlebnis mit einer befreundeten Native-Americans-Familie, die sehr abgelegen wohnte. Einmal im Jahr pflegte er sie zu besuchen. Doch obwohl er immer zu anderen Zeiten und stets unangemeldet auftauchte, war zu seiner Überraschung doch jedes Mal alles für ihn vorbereitet. »Wir wussten, dass du kommst« oder »Wir haben schon auf dich gewartet«, hieß es. Ganz eindeutig handelte es sich hier um einen Fall von Hellseherei, also um etwas typisch »Indianisches«, dachte er und war jahrelang fasziniert davon. Schließlich fasste er sich ein Herz und fragte, woher sie denn eigentlich immer von seinem Kommen wüssten. Das Lachen und die schlichte Antwort verwirrten ihn sehr: Seine meilenweite Anfahrt über die staubige Straße hinterlasse einen weithin sichtbaren bräunlichen Schweif gegen den klaren Himmel und gäbe Zeit genug, sich auf den Besuch vorzubereiten. Dem Kleinen, Unscheinbaren und Belanglosen Beachtung schenken: Das führt zum sanften Gesetz des Milden Westens. Der hat es in sich - noch im Rauch, in den Steinen, im Staub.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.