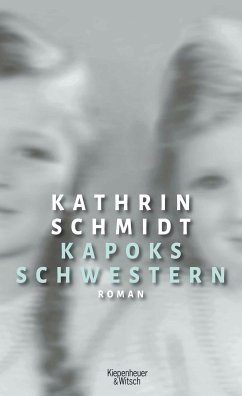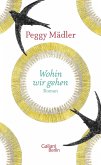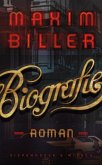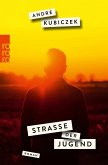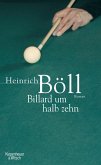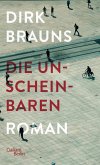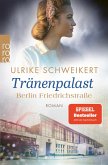Kleine Verhältnisse, große Geschichte: Zwei Nachbarsfamilien in Weitwinkelaufnahme Kathrin Schmidt greift weit aus: Entlang der spannungsreichen Beziehungen der Familien Kapok und Schaechter erzählt sie von Krieg, Flucht, Teilung, Bespitzelung und neuer Freiheit - und von Liebe, Freundschaft, Schuld und Glück. Die Siedlung Eintracht, einst direkt an der Berliner Mauer gelegen, hat ihre Abgeschiedenheit bewahrt. Jahrzehntelang hat Werner Kapok sein Elternhaus, in das seine Schwester Renate gezogen ist, gemieden. Stattdessen gründete er eine eigene Familie und verließ sie schnell wieder. Später gab er seine Professur auf und verschwand. Nun kehrt er zurück, und die Familiengeschichte holt ihn ein. Denn im Haus gegenüber wohnen immer noch die Schaechter-Schwestern Barbara und Claudia, mit denen er groß geworden ist und seine Sehnsüchte teilte. Dass sie ihn, jede für sich, in die Liebe einführten, haben sie einander bis heute verschwiegen. Als dann auch noch Werners verlorener Sohn auftaucht, kann nichts bleiben, wie es war. Alte Geheimnisse, vergessene Leidenschaften, noch immer schwelende Konflikte müssen ans Licht. Kathrin Schmidt erzählt eine große Geschichte aus kleinen Verhältnissen, führt ihre Leser in abgelegene Gegenden, vergangene Zeiten und in die deutsche und europäische Gegenwart. Kunstvoll, mit Gespür fürs Detail, große Gefühle und niedere Instinkte.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, CY, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, IRL, I, L, M, NL, P, S, SLO, SK ausgeliefert werden.