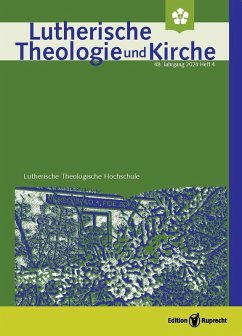Dieses Heft hat einen konkreten, verbindenden Fokus, eine gemeinsame Fragestellung: Wie können wir in der Kirche mit konträren Auffassungen umgehen, wenn uns doch Wesentliches, nämlich das Bekenntnis zur Rechtfertigung aus Glauben um Christi willen, verbindet? Hebt das Differente den Konsens einfach auf? Oder ist ein - zumindest zeitweises und vorläufiges - Zugleich von Trennendem und Verbindendem denkbar? Die Beiträge in diesem Heft versuchen in diesen Fragen Wegweisung zu geben, indem sie nach Orientierung und Praxisbeispielen aus der Hl. Schrift und dem Leben der Kirche fragen. Und sie lassen sich anregen von Überlegungen aus dem Umfeld gegenwärtiger Forschungen zu Tendenzen gesellschaftlicher »Polarisierung«. Die Beiträge haben auch darin ein Gemeinsames, dass sie allesamt im Kontext der Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche (SELK) und ihrer aktuellen exegetischen und hermeneutischen Debatten angesiedelt sind, die sich seit Jahren in der Frage des Zusam¬menhangs von Amt und Geschlecht verdichten. Und schließlich ist ihnen gemeinsam, dass es sich um Beiträge handelt, die nicht aus eigenem Antrieb verfasst wurden, sondern von der Kirchenleitung oder von Pfarrkonventen als Impulse für die theologische Arbeit erbeten wurden. In allen Beiträgen geht es darum, das Einende in den Blick zu nehmen. Und sie diskutieren, in was für ein Verhältnis dazu das Trennende zu setzen ist. Diese Diskussion ist nichts völlig Neues. Bereits der 11. Allgemei¬ne Pfarrkonvent der SELK 2009 hatte Gilberto da Silva, Werner Klän und Wolfgang Schillhahn um Referate zum Thema gebeten unter dem Titel »Was uns eint«.(1) Christoph Barnbrock erinnert im ersten Beitrag an diese Referate, um die neueren Überlegungen in diesem Heft an das dort Erarbeitete anzuknüpfen: In kirchengeschichtlicher Perspektive hatte Gilberto da Silva damals die Integration unterschiedlicher kirchlicher Traditionen im Entstehungsprozess der SELK herausgearbeitet. Werner Klän hatte die Stiftung der Einheit der Kirche in der Selbstkundgabe und Selbstgabe Gottes betont, dem alle Bemühung um die Wahrung der kirchlichen Einheit zu entsprechen habe. Und Wolfgang Schillhahn hatte das einheitsstiftende Moment des Gottesdienstes in der lutherischen Kirche in den Blick genommen. Im Beitrag »Was uns eint - trotz mancher Unterschiede« nimmt Christoph Barnbrock nun auf diese und auf eine Vielzahl weiterer Äußerungen Bezug und zeigt die Verbundenheit und das Einende im Leben der Lutherischen Kirche auf. Dabei macht er auch deutlich, dass heutige Differenzen nur punktuell über die Vielfalt hinausgehen, die es in den Vorgängerkirchen der SELK gab. Angesichts der trotzdem verbreiteten Wahrnehmung einer sich verstärkenden Polarisierung entwickelt Barnbrock einen ganzen Fächer an geistlichen Anregungen und theologischen Überlegungen, wie einer solchen Polarisierung in der Kirche entgegen gewirkt werden könne. Christian Neddens schließlich ist um eine Stellungnahme gebeten worden zur konkreten Frage: »Wie kann eine polarisierte Gemeinschaft miteinander zurechtkommen?« Den Ausgangspunkt seiner Überlegungen nimmt er bei aktuellen Ergebnissen der gesellschaftli¬chen Konflikt- und Konsensforschung und fragt weiter, inwieweit sich deren Einsichten auf die kirchliche Situation übertragen lassen. Anknüpfend daran skizziert er Wege aus der Konfliktfalle, nimmt Maß an biblischen Beispielen und diskutiert, inwiefern auch »Kompromisse« theologisch legitim oder sogar bedeutsam sein können. Die Confessio Augustana, die grundlegende lutherische Bekenntnisschrift, wird schließlich als zukunftsweisendes Modell vorgestellt, wie mit der Differenz zwischen Übereinstimmung und Strittigem umgegangen werden kann. (1) Veröffentlicht in LuThK 33 (2009), 131-173. Christoph Walther hat vor Kurzem eine Biographie zu Gottfried Nagel (1876-1944) vorgelegt, der in bewegter Zeit Präsident der Evangelisch-Lutherischen (altlutherischen) Kirche in Preußen war. Nun ist Walther einer weiteren, bisher wenig beachteten Frage in diesem Kontext nachgegangen, nämlich nach dem Umgang mit dem altlutherischen Kirchenvermögen in den neupolnischen Gebieten nach 1945. Die altlutherische Kirche büßte nach dem Krieg ihre Gemeinden und ihr Kirchenvermögen in den ehemals deutschen Gebie¬ten fast vollständig ein. Dessen Inbesitznahme durch Privatleute, den Staat oder die römisch-katholische Kirche gestaltete sich sehr unterschiedlich in einer chaotischen Umbruchsituation und unter unübersichtlichen, teils widersprüchlichen juristischen Regelungen. Überschattet war all dies vom Eindruck der Kriegserfahrungen unter deutscher Besatzung und der tiefgreifenden territorialen und politischen Umbruchsituation zur kommunistisch geprägten Volksrepublik Polen. Walther beschreibt zunächst die Situation der altlutherischen Kirche und der anderen evangelischen Kirchen nach Kriegsende, schildert die widersprüchlichen juristischen Regelungen der ersten Nachkriegsjahre und analysiert die häufig willkürliche Aneignungspraxis staatlicher Stellen sowie die Rechtlosigkeit der deutschen Bevölkerung nach dem 2. Weltkrieg. Berührend ist die Schilderung, wie altlutherische Pastoren und Lektoren ihren Dienst für die Gemeinden trotz widrigster Bedingungen fortzuführen suchten und wie sich die verbliebenen Leitungsverantwortlichen der unterschiedlichen evan¬gelischen Gemeinden gegenseitig in ihrer Not unterstützten. Zurecht weist Walther darauf hin, dass es höchste Zeit ist, in Gestalt von oral history nach noch vorhandenen Erinnerungen zur Übernahme bzw. zum Verbleib von altlutherischem Kirchenvermögen zu forschen - und darüber hinaus überhaupt zum Schicksal der altlutherischen Kirche in den Ostgebieten und zu den Neuanfängen im Westen nach 1945. Der dritte Beitrag in diesem Heft stammt vom Schriftleiter selbst. Christian Neddens unterzieht die aktuellen Rechtsgrundlagen zum sogenannten »assistierten Suizid« einer kritischen theologischen Analyse und macht einen Vorschlag zu einem lutherisch verantworteten Umgang mit Sterbewünschen schwer suizidaler Menschen. Neddens stellt zunächst einen Paradigmenwechsel fest, der 2020 in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zum assistierten Suizid stattgefunden habe. Im damaligen Urteil werde die Menschenwürde erstmals ausschließlich von der individuellen Selbstbe¬stimmung her begründet, während das Recht auf Leben und körperli¬che Unversehrtheit dahinter zurücktritt. Diese Rechtsbegründung beruht auf anthropologischen Vorannahmen, die in ihrer Stichhaltigkeit erst zu klären wären. Aber auch kirchlich-theologische Positi-onierungen in dieser Frage waren in ihrer Argumentation oft kurzatmig, so der Verfasser. Neddens entwickelt deshalb eine doppelte Argumentationslinie vom lutherischen Dual »Gesetz und Evangelium« her, um Menschen in ihrer Selbstbestimmung zu unterstützen. Entscheidend sei bei diesen schweren Fragen am Ende des Lebens, ob es gelinge, ein gesellschaftliches Klima zu schaffen, das Menschen hilft, das eigene Leben anzunehmen - und manchmal auch durchzustehen. (aus dem Editorial von Schriftleiter Christian Neddens)
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.