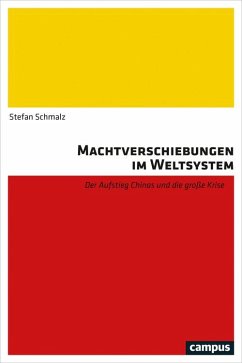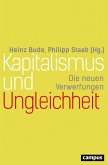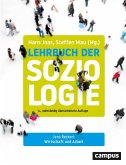China hat einen atemberaubenden wirtschaftlichen Aufstieg erlebt. Das Land fordert heute die USA und ihre Verbündeten heraus - ökonomisch, militärisch und politisch. Doch der Aufstieg verläuft keineswegs reibungslos: Innenpolitisch kämpft die chinesische Staatsführung mit Überkapazitäten in der Industrie, wachsender Verschuldung, Korruption und sozialen Konflikten. Auf der globalen Ebene sieht sich China dem US-amerikanischen Militärbündnissystem, der Vorherrschaft des US-Dollars auf den Finanzmärkten und der Dominanz westlicher Technologie gegenüber. Das Buch untersucht die komplexe Machtverschiebung im Weltsystem und beschreibt, wie der systemische Umbruch zu wachsender Instabilität und Krisen führt.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.