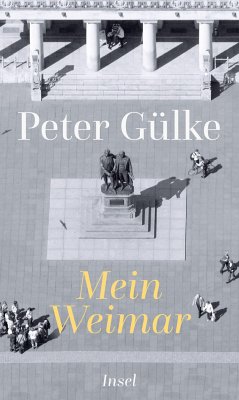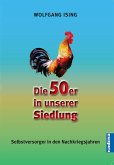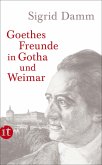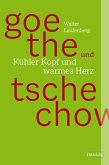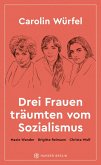Weimar - 'Ilm-Athen' und 'Goethestadt' mit dem Nachbarort Buchenwald. Der berühmte Dirigent, Musikwissenschaftler und Schriftsteller Peter Gülke, Nachfahre der Familie Vulpius, vergegenwärtigt sich in diesem Buch die prägenden Erfahrungen seines Lebens: die Kindheit in einer Stadt, die 'der Führer' so gern besuchte; die Jugend in der stalinistischen DDR; der Musikerberuf im gelenkten Staat; 1983 dann der Entschluss, das Land zu verlassen, weil der Druck seitens der Stasi unerträglich geworden war; 1990 Rückkehr in sein 'fernes, nahes, geschändetes, geliebtes Weimar', das eine andere Stadt geworden ist. Immer wieder öffnen sich Aussichten auf vergangene Epochen, treten Goethe, seine Frau Christiane Vulpius, Herder, Schiller, Schopenhauer auf den Plan, aber auch Schubert, Bach, Mendelssohn - wie überhaupt Porträts von Musikern und brillante Musikbeschreibungen einen weiteren Schwerpunkt des Buches bilden. Ein wiederkehrendes Motiv sind die Besuche auf dem Ettersberg und dabei der Versuch, sich 'das Unfassliche' des Menschheitsverbrechens zu erklären.
'Vielleicht muss einem die Stadt, in der so viel eigene Vergangenheit hängt, ganz verloren erscheinen, um neu erblickt, neu angenommen zu werden.'
'Vielleicht muss einem die Stadt, in der so viel eigene Vergangenheit hängt, ganz verloren erscheinen, um neu erblickt, neu angenommen zu werden.'
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D, I ausgeliefert werden.