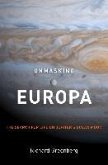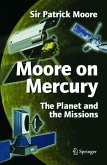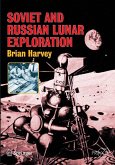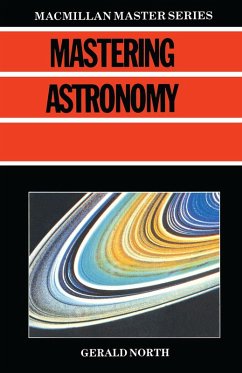In this exciting story of the Galileo mission to investigate Jupiter, noted astronomer Daniel Fischer weaves together the many disparate facts learned about this most fascinating planet and its satellites. Fischer tells the entire story of Galileo: a behind-the-scenes look at its difficult course from idea to reality; its launch; the problems it encountered early on and how these were resolved; and finally, what will become of the probe. Along the way, the author describes what we have learned about Jupiter, including what the Jovian atmosphere is really like, and the peculiar reality of the planets magnetic field. The story of the journey to Jupiter is combined with interesting details about Galileos capacities and a graphic description of the solar system, with an episode on how Galileo would judge the chances of finding life on Earth. The book concludes with a look at the future, closing on the Cassini probe to Saturn. Beautifully illustrated and well written, Mission Jupiter shows us space exploration at its best and clearly and vividly conveys the essential science.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.