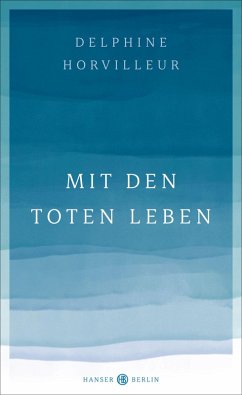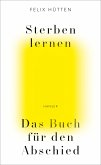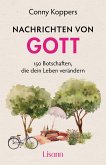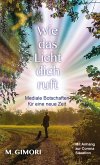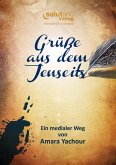Delphine Horvilleur ist eine der wichtigsten intellektuellen Stimmen Frankreichs. Ein aufrichtiges und tröstliches Buch, das uns mit der Endlichkeit des Lebens versöhnt. Dass zum Leben der Tod gehört, ist die älteste und am konsequentesten verdrängte Wahrheit der Welt. Umso größer ist das Bedürfnis nach Ritualen und spiritueller Begleitung, wenn wir damit konfrontiert sind - unabhängig von jedem Glauben. In ihrem sehr persönlichen Essay gewährt Delphine Horvilleur Einblicke in ihre Aufgabe als Rabbinerin, Tag für Tag Menschen in dieser Situation beizustehen. Dabei erweist sie sich als Geschichtenerzählerin, der es gelingt, die Sphären des Lebens und des Todes mit der Kraft des Wortes zu überbrücken. Horvilleur schöpft aus dem Schatz der jüdischen Kultur, aber auch aus ihren eigenen Erfahrungen als Frau, als Mutter, als Tochter. Mit den Toten leben ist ein Buch, das vom Tod erzählt und das Leben feiert.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D, L ausgeliefert werden.
"Ein facettenreicher und trotz des Themas stellenweise fast heiterer Essay ... Horvilleur ist als eine der wenigen französischen Rabbinerinnen eine Galionsfigur des liberalen französischen Judentums, die sich vernehmlich in gesellschaftliche Debatten um Antisemitismus einmischt ... Doch sie tut dies nicht lautstark, sondern ausgestattet mit einer feinen Beobachtungsgabe, mit großer Formulierungskunst und als profunde Kennerin der jüdischen Tradition." Sonja Asal, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 26.07.22 "Horvilleur hat ein Buch geschrieben, das ob seines Reichtums an Kenntnissen und Geschichten, der Kühnheit seiner Gedankenarchitektur und der schönen Klarheit seiner Sprache wieder und wieder gelesen werden kann. Ihren unverwechselbaren Ton aus Gelehrsamkeit, brillanter Beweisführung und Zugriff auf die Gegenwart kennt man aus ihrem vorherigen Buch 'Antisemitismus' ... Mit dem Geschick einer geborenen Geschichtenerzählerin wirkt Horvilleur eine feine Textur, in der beide aufgehoben sind, die Lebenden und die Toten. In diesem Gewebe antworten die Stimmen aufeinander, entsteht eine Resonanz, kein Diesseits oder Jenseits. Im Schreiben wird sie zur Gastgeberin, an deren Tafel alle willkommen sind. Darin besteht das eigentliche Antidot gegen die Schrecken des Todes." Christina Bylow, Tagesspiegel, 16.02.22 "Die Angst vor dem eigenen Erlöschen wird man nie ganz los werden. Aber man kann dem Faktum seiner eigenen Endlichkeit mit einer Prise Humor begegnen, findet Delphine Horvilleur ... [Ihr] Buch ist weder eine philosophische Abhandlung noch ein tränenstimulierender Trauerratgeber, sondern eine anregende und immer wieder auch erstaunlich amüsante Geschichtensammlung." Günter Kaindlstorfer, Deutschlandfunk, 30.05.22 "Ein tröstliches, versöhnliches Buch, das hoffentlich auch uns ermöglicht, eines Tages leichten Herzens zu gehen." Andrea Heinz, an.schläge, 14.03.22 "Horvilleurs Beobachtungs- und Formulierungsgabe sind gleichermaßen ausgeprägt, so dass der sehr persönlich gefärbte Essay stellenweise fast heiter daherkommt. ... Ein tröstliches und empathisches schmales Buch über die Endlichkeit des Lebens." zeitzeichen, 26.10.22 "Für dieses Buch benötigt man nicht einen Bleistift, sondern mehrere, ... um so viel auf den Textseiten anzustreichen, herauszuschreiben und zu memorieren. Mit sich zu tragen, über die Lektüre, über den Tag hinaus. ... Delphine Horvilleur schreibt klar, ohne in gefühlige Naivität oder in leeren rhetorisch pathetischen Klingklang zu verfallen. ... Diesem schmalen, von Nicola Denis gut übersetzten Buch ist große Eindringlichkeit ebenso zu eigen wie großes Gewicht." Alexander Kluy, wina, 24.03.22 "Horvilleur erweist sich als Geschichtenerzählerin, der es gelingt, die Sphären des Lebens und des Todes mit der Kraft des Wortes zu überbrücken. Horvilleur schöpft dabei aus dem Schatz der jüdischen Religion und Kultur, aber auch aus ihren eigenen Erfahrungen als Frau, als Mutter, als Tochter. 'Mit den Toten leben' ist ein Buch, das vom Tod erzählt und das Leben feiert." Jüdische Gemeindezeitung, 14.09.22