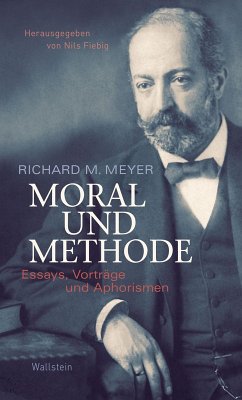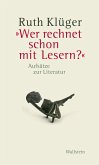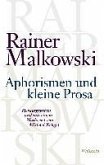Zum 100. Todestag Richard M. Meyers am 8. Oktober 2014: eine Auswahl der Essays des renommierten Berliner Germanisten. »Aus der Liebe zu Sprache und Poesie ist die Philologie erwachsen und ohne sie verdorrt sie, wo noch so viele Quellen fließen." In zahlreichen philologischen Aphorismen wie diesem brachte Richard M. Meyer (1860-1914) die große Leidenschaft seines Lebens zum Ausdruck - die Literaturwissenschaft als »eine lange Liebe zur Dichtkunst". Nils Fiebig legt hier eine Quellensammlung vor, die das breitgefächerte Themenspektrum aufzeigt, aus dem sich die »lange Liebe" des Berliner Germanisten nährte: Abhandlungen über Gerhart Hauptmann, »Goethe in Venedig" und »Nietzsches Zarathustra" - für Meyer »das größte und im gewissen Sinne das einzige wahre Epos, das in der neuen Zeit entstand". Beiträge »Über den Begriff der Individualität", »Über das Verständnis von Kunstwerken" und Meyers philologische Aphorismen ergänzen die Themenpalette der Edition.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.