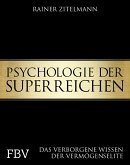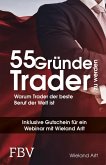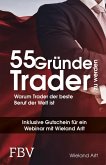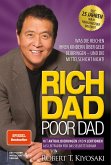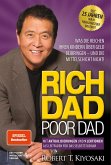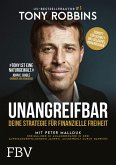Es wird viel über sie spekuliert, doch nur wenige wissen, wie sie wirklich ticken: die Superreichen. Was treibt Menschen um, die ein Vermögen von Dutzenden Millionen oder gar Milliarden Euro angehäuft haben? Der Autor, selbst Multimillionär, hat intensive Gespräche mit 45 Hochvermögenden geführt. Die meisten sind Selfmade-Multimillionäre und besitzen ein Nettovermögen zwischen 30 Millionen und 1 Milliarde Euro. Er sprach mit ihnen über ihre Jugend, Motive, Einstellungen, Erfolgsstrategien und den Umgang mit Rückschlägen. Zudem absolvierten alle einen Persönlichkeitstest. Das Ergebnis ist ein einmaliger Einblick in die Psyche der deutschen Vermögenselite, wie es ihn nie zuvor gab. Zitelmanns Studie wurde an der Universität Potsdam als Dissertation angenommen, mit magna cum laude bewertet und erscheint mit Psychologie der Superreichen erstmals auch als Buch. Anders als die Armutsforschung steckt die Reichtumsforschung in Deutschland noch in ihren Anfängen. Dies ist die erste Untersuchung über die Hochvermögenden, die ein mindestens zweistelliges Nettomillionenvermögen besitzen. Über viele Monate führte der Autor Interviews mit ihnen, die über 1700 Seiten füllten. Im Mittelpunkt stand dabei die Frage nach den Persönlichkeitsmerkmalen, Erfahrungen und Einstellungen, die die Basis für den ungewöhnlichen finanziellen Erfolg dieser Menschen waren. Wie denken und fühlen Menschen, die es oft aus dem Nichts heraus schafften, einen ungeheuren Reichtum aufzubauen? Auch die Hochvermögenden selbst kommen sehr ausführlich zu Wort. So erhält der Leser einen tiefen und authentischen Einblick in eine Welt, die den meisten Menschen fremd ist.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.