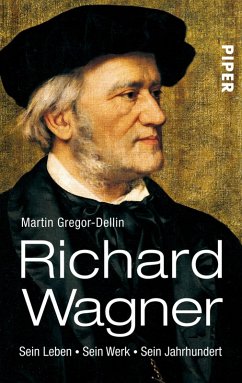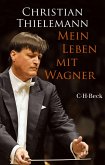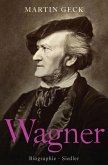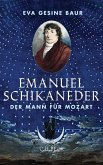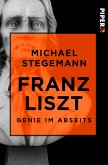Der Versuch, sozusagen aus der Sicht eines Schriftstellers, kundig durch Herausgeberschaften, die Biographie eines Musikers zu schreiben, misslingt eher. Zerrbilder werden an einander gereiht, die – fast naturgemäß, vielleicht aufgrund des Rückgriffs auf die zitierte, eher an der Musik orientierte
Literatur - eine Stellung innerhalb der Musikschriftstellerei, aber kein eigenständiges Leben…mehrDer Versuch, sozusagen aus der Sicht eines Schriftstellers, kundig durch Herausgeberschaften, die Biographie eines Musikers zu schreiben, misslingt eher. Zerrbilder werden an einander gereiht, die – fast naturgemäß, vielleicht aufgrund des Rückgriffs auf die zitierte, eher an der Musik orientierte Literatur - eine Stellung innerhalb der Musikschriftstellerei, aber kein eigenständiges Leben haben.
Schon der Held gerät allenfalls verwackelt. Er wird als unangenehmer, ständig andere an der Nase herumführender, kurzsichtiger Zappelphilipp dargestellt, der ein allen Zweifeln enthobenes Werk geschaffen hat, ohne dass er irgendwelche Zeichen spielerische Genialität an den Tag legt.
Auch Gregor-Dellins Einzelbetrachtungen gewinnen keine Kontur: Beckmesser etwa soll aufgrund seiner Texte ernst genommen werden, aber als was wohl? Handlung und Musik erlaubt ihm den expressionistischen Dichter nicht, ein Revolutionär wie vielleicht Alberich oder allenfalls auch Klingsor kann er zwar in einer entsprechenden Inszenierung sein, der Literat, der Derartiges mit Worten plausibel machte, müsste aber doch außerordentlich sein. Musikalisch mag der Mime näher an das gekommen sein, was bald nach Wagner etwa in der Person Saties Sensation machte, Gregor-Dellin interessiert sich für die entsprechenden Möglichkeiten nicht.
Über Ludwig II bekommen wir nahegelegt, er könne Wagner nicht wegen der Musik geschätzt haben, weil er selbst kein guter Musikschüler gewesen sei (als habe Musikhören und -ausüben unmittelbar etwas miteinander zu tun) und habe Musikprogramme willkürlich zusammengestellt, von denen wir aber weiter nichts hören. Statt, wie häufig, Friedrich Wilhelms III Theaterbesuche lächerlich zu machen, die ja auch die Zauberflöte eingeschlossen haben müssen, versteht man möglicherweise über den Portraitierten mehr, wenn man den Zeitgeschmack, die damals herrschende Verniedlichung, die ja auch ETA Hoffman scharf anging, sich vorstellt. Dass Ludwig II, wie so viele, gerade von dem scheinbar Unmusikalischen bei Wagner, davon angezogen war, dass Wagner auch für den Klänge liebenden greifbarere als die bisherigen Formen fand als bisher üblich, nicht zufällig Extremes in Musikform goss, kann man sich nach der Lektüre von Gregor-Dellin nicht vorstellen, obwohl etwa zur Zeit der Entstehung dieser Biographie Elmar Budde eben dies plausibel zu machen vermochte.
Besonders unangenehm, wenn, nachdem er Wagner lange Abschied nehmen hat lassen, er Cosima scheinbar für Wagners Tod aufgrund einer schein-souverän angedeuteten Eifersuchtszene, obwohl vorherige Eheprobleme eher ausgeblendet wirken.
Geradezu peinlich für einen Literaten ist, wie Fontane (auch etwa zur selben Zeit, als Gregor-Dellins Biographie erschien, hat hingegen Wiesler die Flucht Fontanes aus Bayreuth wirkungsvoll in einen Zusammenhang gebracht) für die Interpretation des Rings in Anspruch und gleich wieder weggeblendet wird, als könnte ein Großer wie Fontane kein Gespür etwa für die Grausamkeit mit der Wagners Gestalten, etwa Woton, laut z. B. des Gesprächs Waltraute-Brünhilde mit seiner Tochter oder Siegried im "schlag mich oder sei mein Freund" mit anderen umgehen konnte, sie als opern- und vielleicht theatertypisch nachvollziehbar charakterisieren.
Wenn schon ein Literat über Musik, dann doch lieber so wie in Werfels Verdi!