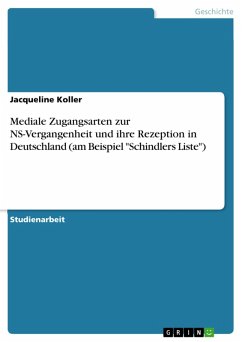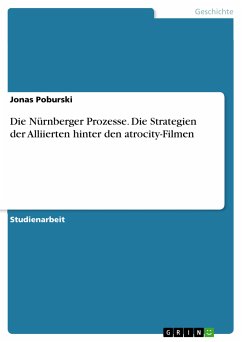Studienarbeit aus dem Jahr 2025 im Fachbereich Geschichte Deutschlands - Nationalsozialismus, Zweiter Weltkrieg, Note: 1,3, FernUniversität Hagen (Public History), Veranstaltung: Semester, Sprache: Deutsch, Abstract: Der Holocaust stellt eines der dunkelsten Kapitel der Menschheitsgeschichte dar und fordert die Gesellschaft bis heute heraus, sich mit Fragen von Erinnerung, Verantwortung und Menschlichkeit auseinanderzusetzen. Mit dem allmählichen Verschwinden der Zeitzeug*innen gewinnen neue Formen der Geschichtsvermittlung an Bedeutung, insbesondere audiovisuelle Medien. Filme wie Steven Spielbergs "Schindlers Liste" (1993) spielen eine zentrale Rolle in der Erinnerungskultur, da sie historische Ereignisse nicht nur repräsentieren, sondern auch emotional erfahrbar machen und zur Reflexion anregen. "Schindlers Liste" hat das öffentliche Bild des Holocaust maßgeblich geprägt und gilt als Meilenstein der filmischen Auseinandersetzung mit diesem Thema. Der Film erzählt die Geschichte des deutschen Industriellen Oskar Schindler, der während des Zweiten Weltkriegs über 1000 jüdische Menschen vor dem Tod rettete. Sein Engagement symbolisiert die Hoffnung und die Würde der freien Gemeinschaft. Ein Zitat aus "Schindlers Liste" betont: "Wer ein einziges Leben rettet, rettet die ganze Welt." Durch die Verbindung einer repräsentativen Ästhetik, symbolischer Elemente wie dem Mädchen im roten Mantel und einer eindringlichen Erzählweise gelingt es Spielberg, sowohl die Grausamkeit als auch die Hoffnung jener Zeit zu vermitteln. Dabei steht nicht nur die historische Rekonstruktion im Vordergrund, sondern auch die Frage nach der individuellen Verantwortung und dem moralischen Handeln. Im Kontext der Public History, die der Vermittlung und Interpretation von Geschichte außerhalb akademischer Fachkreise gewidmet ist, nehmen Filme wie Schindlers Liste eine besondere Stellung ein. Sie sind repräsentativ, erreichen ein breites Publikum, regen gesellschaftliche Debatten an und prägen das kollektive Gedächtnis nachhaltig. In der vorliegenden Arbeit wird untersucht, wie "Schindlers Liste" als Medium der Public History zur deutschen Erinnerungskultur an den Holocaust beiträgt. Im Mittelpunkt stehen drei zentrale Schlüsselsequenzen: das Mädchen im roten Mantel als Symbolfigur, die Grausamkeit der Erschießungen durch der NS-Täter Amon Göth sowie Oskar Schindlers Zusammenbruch. Anhand dieser Szenen wird analysiert, welche narrativen und ästhetischen Mittel im Film eingesetzt werden, wie der Film kollektive Erinnerung gestaltet und welche Rolle er im Bildungsbereich sowie im öffentlichen Gedenken spielt.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.