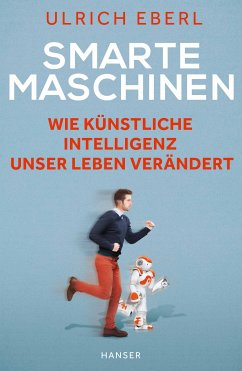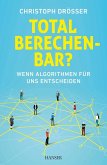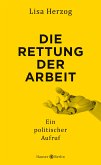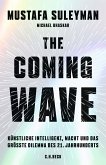Die Maschinen sind erwacht. Sie lernen kochen und musizieren, denken und debattieren. Manche Geräte übertreffen uns bereits: Sie stellen bessere Diagnosen als Ärzte, beherrschen 20 Sprachen oder erkennen technische Probleme, noch bevor ein Zug ausfällt. Wohin führt das in der Zukunft? Sind Roboter und smarte Computer ein Segen? Für den Umbau unserer Energiesysteme, für lebenswerte Städte und die alternde Gesellschaft? Oder eher eine Gefahr für Arbeitsplätze, Privatsphäre und Sicherheit? Ulrich Eberl hat weltweit in den führenden Labors recherchiert. Anschaulich schildert er die faszinierenden Entwicklungen auf dem Gebiet, das den Kern unseres Selbstverständnisses trifft: die menschliche Intelligenz.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.