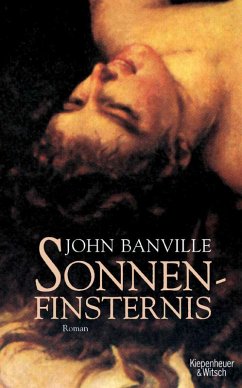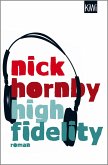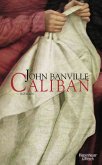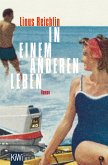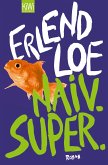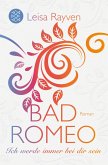Auf dem Höhepunkt seiner Karriere, mit 50 Jahren, verlässt Alexander Cleave mitten in einem Monolog für immer die Bühne. Und nicht nur die Bühne, auch die Rollen im Leben, in denen er als Ehemann und Vater gescheitert ist. Er zieht sich in sein Elternhaus zurück und versinkt in der Vergangenheit, auf der Suche nach sich selbst und seinen Versäumnissen. Wie Gespenster tauchen seine Eltern auf, Cass, seine hochbegabte, psychisch kranke Tochter. Er fühlt sich von Phantomen umzingelt. Aber auch die Wirklichkeit lässt ihn nicht los. Da ist Quirke, ein unheimlicher Typ, der das Haus versorgt, und seine Tochter Lily, die für Cleave zur Ersatztochter wird. Seine Frau Lydia kommt, um ihn aus seiner Krise herauszureißen. Von Cass erreichen Cleave Botschaften, von denen die letzte zeigt, dass die drohenden Schatten nicht nur aus der Vergangenheit stammen, sondern düstere Boten der Gegenwart sind.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, CY, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, IRL, I, L, M, NL, P, S, SLO, SK ausgeliefert werden.