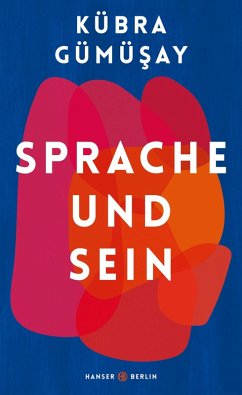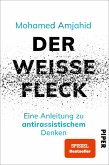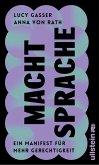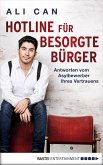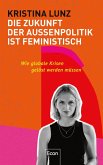Kübra Gümüsay beschreibt wie Sprache unser Denken prägt und unsere Politik bestimmt. "Ein beeindruckendes Buch, poetisch und politisch zugleich." Margarete Stokowski Dieses Buch folgt einer Sehnsucht: nach einer Sprache, die Menschen nicht auf Kategorien reduziert. Nach einem Sprechen, das sie in ihrem Facettenreichtum existieren lässt. Nach wirklich gemeinschaftlichem Denken in einer sich polarisierenden Welt. Kübra Gümüsay setzt sich seit langem für Gleichberechtigung und Diskurse auf Augenhöhe ein. In ihrem ersten Buch geht sie der Frage nach, wie Sprache unser Denken prägt und unsere Politik bestimmt. Sie zeigt, wie Menschen als Individuen unsichtbar werden, wenn sie immer als Teil einer Gruppe gesehen werden - und sich nur als solche äußern dürfen. Doch wie können Menschen wirklich als Menschen sprechen? Und wie können wir alle - in einer Zeit der immer härteren, hasserfüllten Diskurse - anders miteinander kommunizieren?
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D, L ausgeliefert werden.
"Inspirierend und wegweisend: Eine durchweg bereichernde Lektüre, von der man sich nur wünschen kann, Entscheidungsträger:innen in Politik, Medien und Co. würden sie lesen, verstehen und beherzigen." Janine Napirca, Frankfurter Neue Presse, 04.08.23 "Gümüsays Thesen sind ein Weckruf." Ciani-Sophia Hoeder, Die Dame, 08.10.20 "Ein hochaktuelles Buch, unbedingt lesenswert." Tilmann Warnecke, Tagesspiegel, 23.06.20 "Ein persönliches und frisches Plädoyer dafür, den eigenen Blick auf die Welt nicht als gegeben hinzunehmen und andere Perspektiven weder abzulehnen noch zu fürchten." Bettina Baltschev, MDR Kultur, 20.05.20 "Ein Pamphlet für eine Gesellschaft, deren Mitglieder trotz wachsender Unterschiede miteinander reden können." Jury der Sachbuch-Bestenliste Die Zeit, 26.03.20 "Ein lebendiges Plädoyer für mehr Verständnis und eine gerechtere Gesellschaft." WDR Westart, 07.03.20 "'Sprache und Sein' entschlüsselt unsere Gegenwart und macht deutlich, was uns verbindet, nämlich die Sehnsucht danach, so frei sprechen zu können, wie als wir die ersten Worte lernten." Nils Minkmar, Der Spiegel, 07.03.20 "Wer Gümüsays Buch ... liest, sieht manches eigene Verhaltensmuster, manche Gedankenlosigkeit anders. Die Stärke des Buches leigt in dieser Zumutung einer anderen Perspektive und der Erschütterung der eigenen." Martin Ebel, Tages-Anzeiger, 22.02.20 "Kübra Gümüsay erzählt, argumentiert, zitiert 'Sprache und Sein' mit solch einer Dringlichkeit, Fantasie und furchtloser analytischer Schärfe, dass jede Seite ein Hochgenuss ist. Man hört, spricht anders danach und will das Buch in die Schulen tragen." Barbara Weitzel, WELT am Sonntag, 16.02.20 "Ein kluges, klares, sehr persönliches Buch ... mit einer wichtigen Botschaft." Pascal Fischer, SWR lesenswert, 12.2.20 "Eine Streitschrift für eine neue Sprache im öffentlichen Diskurs. Eine Streitschrift allerdings, die dem Kampfgetöse entgegenwirkt durch einen persönlichen Ton und eine zum Dialog einladende Geste." Paul Stoop, Deutschlandfunk, 10.02.20 "Eine leidenschaftliche Verteidigungsrede kultureller Vielfältigkeit. ... 'Sprache und Sein' ist frisch wie der Morgentau. Das liegt daran, dass es den Versuch unternimmt, mit guten Argumenten und anschaulichen Beispielen um eine bessere Welt zu ringen." Katharina Teutsch, Die Zeit, 30.01.20 "Der Kampf um Individualität, um die eigene Sprache, der Kampf darum, den Graben zu schließen, zwischen dem, was sie sich entschieden hat zu sein, und dem, worauf sie festgelegt wird - und zwar der kollektive Kampf aller Marginalisierten und im Speziellen ihrer Generation: Kübra Gümüsays Buch ist dafür ein kraftvolles, mit vielen interessanten Verweisen und Zitaten gespicktes Manifest." Ambros Waibel, taz, 29.01.20 "'Sprache und Sein' ist aufschlussreich und engagiert. ... Es wäre wünschenswert, dass sich möglichst viele Leserinnen und Leser, die möglichst verschieden von Gümüsay sind, autobiografische Berichte wie ihren möglichst genau durchlesen und eine Inventur dessen vornehmen, was sie als selbstverständlich erleben dürfen." Hanna Engelmeier, Zeit Online, 29.01.20 "Am stärksten, wenn die Autorin am eigenen Beispiel zeigt, wie sie als Benannte unter Unbenannten an ihrem Traum von einer Gesellschaft, in der' alle gleichberechtigt sprechen und sein können' festhält. ...Ihr demokratisches Anliegen, die Sprache zu einem Zuhause für alle zu machen, vertritt sie klug und leidenschaftlich." Ralph Gerstenberg, Deutschlandfunk, 27.01.2020 "Der Buchtitel 'Sprache und Sein' klingt nach Heidegger, handelt aber keinesfalls vom Geworfensein in unsere sprachliche Gegenwart, sondern vom Auftrag, sie zu gestalten." Marc Reichwein, Die Welt, 27.01.20 "Die von Gümüsay angesprochenen Themen sind wichtig: das Bewusstsein für die Macht der Sprache, die gegenwärtige Diskursverschiebung nach Rechts, das Plädoyer dafür, Menschen auch außerhalb von Kategorien sprechen zu lassen." Azade Pesmen, Deutschlandfunk Kultur, 27.01.20 "Dieses Buch ist ein Befreiungsschlag - und ein kluger Essay von literarischer Qualität und politischer Kraft." Martina Läubli, Neue Zürcher Zeitung, 26.01.20