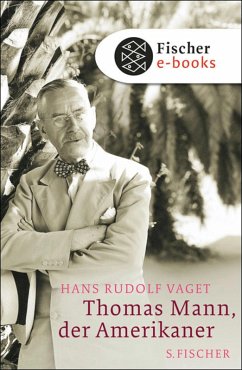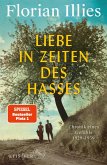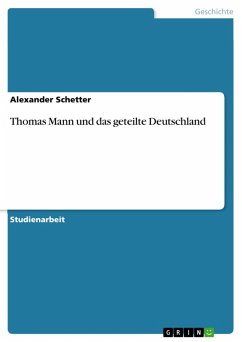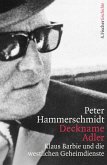Zwei Liebschaften machten aus dem Exilanten Thomas Mann einen „Amerikaner“. Da war zuerst der schmachtende Enthusiasmus, mit dem Agnes Meyer ihrem Idol begegnete. Ihre Verliebtheit hatte sich an erotischen Szenen in „Joseph in Ägypten“ entzündet; nun suchte sie entschlossen die Nähe des berühmten
Autors. Thomas Mann zog sich mit Mühe aus der Affäre, liess seine Verehrerin aber in vielen Briefen an…mehrZwei Liebschaften machten aus dem Exilanten Thomas Mann einen „Amerikaner“. Da war zuerst der schmachtende Enthusiasmus, mit dem Agnes Meyer ihrem Idol begegnete. Ihre Verliebtheit hatte sich an erotischen Szenen in „Joseph in Ägypten“ entzündet; nun suchte sie entschlossen die Nähe des berühmten Autors. Thomas Mann zog sich mit Mühe aus der Affäre, liess seine Verehrerin aber in vielen Briefen an seinen Gedanken teilhaben. Sie belohnte diese Vertrautheit: ihr Einfluss verschafften ihm die Anstellungen in Princeton und an der Library of Congress, ihr Geld half mit der Bürgschaft für sein Haus in Kalifornien, und sie assistierte bei seiner Einbürgerung. Literarisch war sie ein Modell für die Frau von Tolna im „Doktor Faustus“ und für die Verführerin Thamar des Joseph-Romans.
Bei der zweiten Romanze war Thomas Mann der Bewunderer, der Bewunderte Franklin D. Roosevelt, US-Präsident von 1933 bis 1945. Diesen an Kinderlähmung leidenden, aber lebensfrohen Politiker bewunderte Thomas Mann über alles. In ihm sah er den mystischen Helden, der als „Caesar im Rollstuhl“ das Monster Hitler besiegen würde und dessen Genius er, Thomas Mann, mit Vorträgen und Radioansprachen bis zum bitteren Ende unterstützen würde. Es ist zweifelhaft, ob Roosevelt je ein Buch von Thomas Mann geöffnet hat. Obwohl also Roosevelt Thomas Manns Hingabe nicht erwiderte, bekam Joseph der Ernährer, der in den USA geschrieben wurde, Züge von Roosevelt, und der New Deal wurde Vorbild für Josephs Wirtschaftspolitik in Ägypten.
Ähnlich wie in diesen beiden Kapiteln über Agnes Meyer und Präsident Roosevelt beleuchtet Hans R. Vaget neun weitere Themenbereiche, darunter Thomas Manns Vortragsreisen in den USA zwischen 1938 und 1943; seine Erfahrungen an amerikanischen Universitäten und in Hollywood (zu gerne hätte er den Joseph-Roman verfilmt gesehen, mit Robert Montgomery in der Titelrolle!); die beängstigende Berührung mit dem Komitee über „unamerikanische Umtriebe“ und dem FBI, wobei Thomas Mann schon früh sah, wie Amerikas Anti-Nazismus sich in einen Anti-Kommunismus wandelte, der den Nährboden für den kommenden kalten Krieg bildete.
Der eigentliche Ehrgeiz dieses Buches offenbart sich im letzten Drittel des Buches. Dort geht es dem Autor um die These, dass Thomas Mann (der bei seiner Ankunft 1938 in New York noch gesagt hatte „Wo ich bin, da ist Deutschland“) in Amerika eine Perspektive auf Deutschlands geschichtliche Schuld gewann, die ihn im Vergleich zu den Daheimgebliebenen auf die „Überholspur der Geschichte“ brachte: „Thomas Mann gewann in den Jahren des amerikanischen Exils einen Vorsprung an historischer und politischer Erkenntnis, die sich in einer von keiner falschen Vaterlandsliebe vernebelten Aussenperspektive auf Deutschland kundtat.“ In Aufsätzen wie „Deutschland und die Deutschen“ habe er aufgezeigt, dass Hitler und der Nationalsozialismus weit in die deutsche Geistesgeschichte zurückgehen, zur Romantik, zu Nietzsche, ja bis zu Luther. Das böse Deutschland, so heisst es, sei das fehlgegangene gute. (Das ist auch die Ein-Deutschland-Theorie des „Doktor Faustus“.) Daraus folge die historische Schuld des gesamten Deutschtums, auch des „deutschen Geistes“. Die Zerstörung der Städte und das Leiden der Menschen im Krieg sei letztlich selbstverschuldet. Man könne sich moralisch nicht entrüsten angesichts der vorangegangenen Zerstörungen englischer Städte. Nachkriegs-Deutschland müsse wissen, dass auch während seiner allmählichen Rehabilitierung vor der Welt die Krematorien der Konzentrationslager auf lange Sicht als das „Denkmal des Dritten Reiches“ im Gedächtnis der Menschen fortleben würden.
Trotz solcher tiefernsten Konklusion ist dieses Buch auch unterhaltsam. Auch für den fachkundigen Leser gibt es noch Entdeckungen zu machen, etwa dass Thomas Mann sich bei dem „Movie-Gesindel“ in Hollywood wohler fühlte als bei den Talaren in Princeton, oder wie es zu einer bemerkenswerten Gedankenverwandschaft zwischen Thomas Mann und Willy Brandt kam.