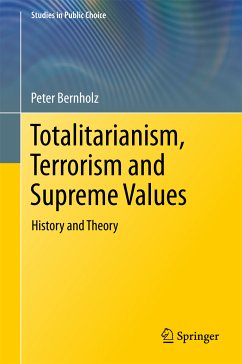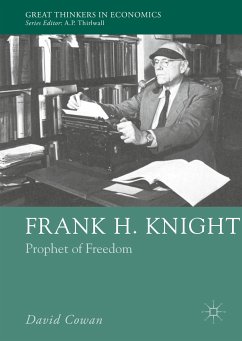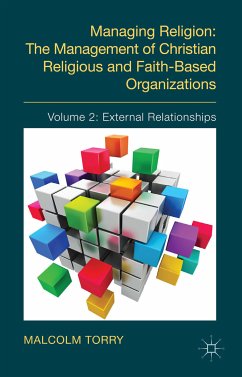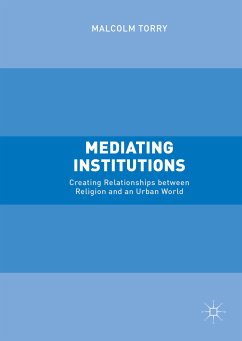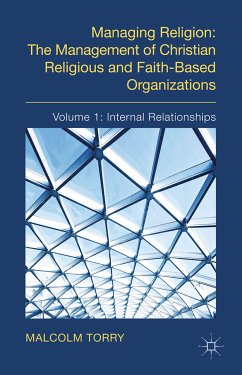Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.
"Bernholz describes supreme-value ideologies that have existed over the ages. He stays literally close to home in describing the supreme values of Adolf Hitler and German National Socialist ideology. ... This book is necessary reading for researchers of defense strategy and the economics of defense, but above all for the politicians and administrators to whom we entrust our safety." (Arye L. Hillman, Public Choice, July, 2018)
"... besticht vor allem durch seinen ungeheuren Reichtum an Details der totalitären Kulturen (oder Unkulturen). Dem Leser wäre die Orientierung erleichtert, enthielte das Buch ein Namensverzeichnis, das mit wenig Zusatzaufwand hätte erstellt werden können. Alles in allem wird das Buch sehr zur Lektüre empfohlen." (Charles B. Blankart, in: ORDO, Jg. 68, Heft 1, 24. April 2018)