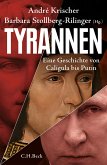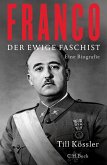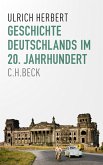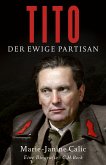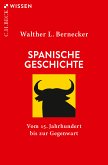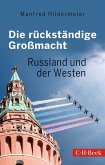VON CALIGULA BIS PUTIN - EINE GESCHICHTE DER TYRANNEI
Tyrannen haben Konjunktur in unseren Tagen. Eine stetig wachsende Zahl von Autokraten ist dabei, dem westlichen Traum vom unaufhaltsamen Siegeszug der Demokratie und Rechtsstaatlichkeit ein Ende zu bereiten: Unter ihnen finden sich kriegslüsterne Despoten wie Putin, aber auch beunruhigende Gestalten vom Schlage eines Kim Jong Un. Und selbst das Ursprungsland der westlichen Demokratie scheint vor dem Absturz in die Tyrannei nicht gefeit.
In dieser Geschichte von Caligula bis Putin gehen renommierte Historikerinnen und Historiker der Frage nach, welche Wesenszüge und Herrschaftsformen Tyrannen eigen sind. So konkret und spannend die Darstellungen der Protagonisten und die Analysen ihrer (Un-)Taten sind, so zeigt sich doch zugleich, dass die Geschichte der Tyrannen stets auch eine Geschichte der sich wandelnden Vorstellungen von unrechter Herrschaft ist. Nicht zuletzt ist sie eine Geschichte der Konflikte um die politische Deutungshoheit über diese Frage.
- Dämonen der Geschichte - zwanzig renommierte Historikerinnen und Historiker erkunden eine Herrschaftsform
- Wo ein Tyrann herrscht, kann keine Freiheit sein
- Eine politische Tendenz zur Tyrannei in unserer Zeit ist auf dem Vormarsch
- Caligula (A. Winterling) Nero (M. Meier) Heinrich IV. (G. Althoff) Richard III. (A. Krischer) Katharina v. Medici (M. Garloff) Ibrahim «der Wahnsinnige» (Chr. Vogel) Ivan IV. «der Schreckliche» u. Peter I. «der Große» (J. Hennings) Friedrich Wilhelm I. (B. Stollberg-Rilinger) Napoleon Bonaparte (D. Schönpflug) Leopold II. (J. Seibert) Franco (C. Rothauge) Mao Zedong u. Jiang Qing (D. Leese) Pinochet (St. Ruderer) Idi Amin (A. Eckert) Mugabe (Chr. Marx) B. al-Assad (G. Steinberg) Kim Il Sung bis Kim Jong Un (E. Ballbach) Erdo?an (K. Konuk) Putin (Karl Schlögel) Trump (M. Hochgeschwender)
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Tyrannei, das klingt so altmodisch, nach "asiatischer" sprich in ihrer Grausamkeit unbegreiflicher Gewaltherrschaft, meint Rezensent Stephan Speicher. Er wundert sich nicht, dass dieser Begriff ein Comeback hat, denn unbegreiflich sind ihm - und den Autoren - auch Erdogan, Putin und Trump. Zwanzig Porträts von Tyrannen findet er in diesem Band versammelt, quer durch die Geschichte. Immer wieder taucht dabei die Frage auf, ob eine Tyrannei nicht gelegentlich auch nützlich sein kann, wenn sie, wie zum Beispiel im Falle Maos das "schlechte Alte" zerschlägt. Man begreift nicht ganz, wie Trump in diese Reihe passt, von dem man viel sagen kann, aber nicht, dass er ein Massenmörder ist. Für Speicher ist dessen Porträt durch Michael Hochgeschwender jedoch ein "Höhepunkt" des Buchs, das er offenbar mit Gewinn gelesen hat.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
?Der Sammelband von Krischer und Stollberg-Rilinger über Tyrannen "von Caligula bis Putin" kann Aufmerksamkeit beanspruchen.?
Frankfurter Allgemeine Zeitung, Stephan Speicher
?Was zeichnet einen Tyrannen aus? Und wie haben sich die Vorstellungen unrechter Herrschaft mit der Zeit verändert? Das fragen sich Historikerinnen und Historiker in dem Buch ?Tyrannen. Eine Geschichte von Caligula bis Putin?.?
Deutschlandfunk, Dieter Kassel
?Historiker analysieren die Herrschaft mächtiger Männer ? mit überraschenden Ergebnissen?
Die ZEIT, Oliver Weber
?Gute Bücher beantworten Fragen. Bessere Bücher stellen Fragen. Dieses also ist ein ganz hervorragendes Buch.?
Wiener Zeitung, Edwin Baumgartner
?Erweitert den geschichtlichen und politischen Horizont, wenn es um die Frage des Missbrauchs von Macht geht.?
spektrum.de, Christian Hellmann
?Eine gewinnbringende Lektüre.?
Damals, Dr. Philipp Deeg
Frankfurter Allgemeine Zeitung, Stephan Speicher
?Was zeichnet einen Tyrannen aus? Und wie haben sich die Vorstellungen unrechter Herrschaft mit der Zeit verändert? Das fragen sich Historikerinnen und Historiker in dem Buch ?Tyrannen. Eine Geschichte von Caligula bis Putin?.?
Deutschlandfunk, Dieter Kassel
?Historiker analysieren die Herrschaft mächtiger Männer ? mit überraschenden Ergebnissen?
Die ZEIT, Oliver Weber
?Gute Bücher beantworten Fragen. Bessere Bücher stellen Fragen. Dieses also ist ein ganz hervorragendes Buch.?
Wiener Zeitung, Edwin Baumgartner
?Erweitert den geschichtlichen und politischen Horizont, wenn es um die Frage des Missbrauchs von Macht geht.?
spektrum.de, Christian Hellmann
?Eine gewinnbringende Lektüre.?
Damals, Dr. Philipp Deeg
Der Sammelband von Krischer und Stollberg-Rilinger über Tyrannen "von Caligula bis Putin" kann Aufmerksamkeit beanspruchen.
Frankfurter Allgemeine Zeitung, Stephan Speicher
Was zeichnet einen Tyrannen aus? Und wie haben sich die Vorstellungen unrechter Herrschaft mit der Zeit verändert? Das fragen sich Historikerinnen und Historiker in dem Buch Tyrannen. Eine Geschichte von Caligula bis Putin.
Deutschlandfunk, Dieter Kassel
Historiker analysieren die Herrschaft mächtiger Männer mit überraschenden Ergebnissen
Die ZEIT, Oliver Weber
Gute Bücher beantworten Fragen. Bessere Bücher stellen Fragen. Dieses also ist ein ganz hervorragendes Buch.
Wiener Zeitung, Edwin Baumgartner
Erweitert den geschichtlichen und politischen Horizont, wenn es um die Frage des Missbrauchs von Macht geht.
spektrum.de, Christian Hellmann
Eine gewinnbringende Lektüre.
Damals, Dr. Philipp Deeg
Frankfurter Allgemeine Zeitung, Stephan Speicher
Was zeichnet einen Tyrannen aus? Und wie haben sich die Vorstellungen unrechter Herrschaft mit der Zeit verändert? Das fragen sich Historikerinnen und Historiker in dem Buch Tyrannen. Eine Geschichte von Caligula bis Putin.
Deutschlandfunk, Dieter Kassel
Historiker analysieren die Herrschaft mächtiger Männer mit überraschenden Ergebnissen
Die ZEIT, Oliver Weber
Gute Bücher beantworten Fragen. Bessere Bücher stellen Fragen. Dieses also ist ein ganz hervorragendes Buch.
Wiener Zeitung, Edwin Baumgartner
Erweitert den geschichtlichen und politischen Horizont, wenn es um die Frage des Missbrauchs von Macht geht.
spektrum.de, Christian Hellmann
Eine gewinnbringende Lektüre.
Damals, Dr. Philipp Deeg
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen: www.buecher.de/agb
Impressum
www.buecher.de ist ein Internetauftritt der buecher.de internetstores GmbH
Geschäftsführung: Monica Sawhney | Roland Kölbl | Günter Hilger
Sitz der Gesellschaft: Batheyer Straße 115 - 117, 58099 Hagen
Postanschrift: Bürgermeister-Wegele-Str. 12, 86167 Augsburg
Amtsgericht Hagen HRB 13257
Steuernummer: 321/5800/1497
USt-IdNr: DE450055826
Bitte wählen Sie Ihr Anliegen aus.
Rechnungen
Retourenschein anfordern
Bestellstatus
Storno