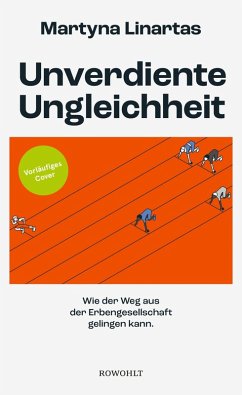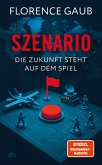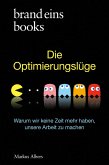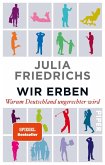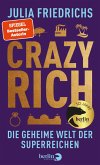Das Buch flankiert einen aktuellen, vor allem von Linken und der SPD vorgebrachten gesellschaftspolitischen Impuls, stützt sich aber wenig auf differenzierte Analysen oder neue Lösungsansätze. Die Argumentation konzentriert sich stark auf moralische Empörung über die ungerechte Vermögensverteilung;
dabei bleibt die Herleitung der Ursachen lückenhaft und die konkreten Reformvorschläge wirken oft…mehrDas Buch flankiert einen aktuellen, vor allem von Linken und der SPD vorgebrachten gesellschaftspolitischen Impuls, stützt sich aber wenig auf differenzierte Analysen oder neue Lösungsansätze. Die Argumentation konzentriert sich stark auf moralische Empörung über die ungerechte Vermögensverteilung; dabei bleibt die Herleitung der Ursachen lückenhaft und die konkreten Reformvorschläge wirken oft mehr plakativ als tragfähig.
Was als fundierte Streitschrift beworben wird, bleibt auf der Ebene des Appells stecken: die Argumente sind bekannt sind und die Analyse auf bekannte Forderungen wie Vermögenssteuer und Auszahlungen an alle junge Menschen lassen die politisch-ökonomischen Realitäten und die Komplexität von Erbschaft und Besitz außen vor. Die mächtige Empörung der Autorin wird durch das am Ende eher schwache Fazit nicht eingefangen, und die analytische Tiefe reicht nicht aus, um das Thema sachlich neu zu definieren oder den Lesern ein überzeugendes Handlungskonzept zu bieten.
Ungerechtigkeit ist, paradox gesprochen, höchst gerecht – denn sie gehört zum Wesen der Freiheit. Wo Menschen frei handeln dürfen, entsteht Unterschied: in Begabung, Fleiß, Glück, Herkunft, Wille. Diese Unterschiede führen zwangsläufig zu Ungleichheit – und was Ungleichheit erzeugt, wirkt auf viele wie Ungerechtigkeit. Doch gerade der Versuch, sie zu beseitigen, schafft erst das wirkliche Unrecht: die Gleichmacherei, die dem Tüchtigen nimmt und dem Gleichgültigen gibt.
Gerechtigkeit kann nicht bedeuten, Ergebnisse zu nivellieren, sondern Chancen zu öffnen. Das Leben verteilt nicht gerecht, aber es prüft jeden in seiner Haltung zum Gegebenen. Wer die Ungerechtigkeit annimmt, lernt Demut, Verantwortung und Eigenkraft. So erweist sich die scheinbare Ungerechtigkeit als die tiefere Gerechtigkeit des Lebens – sie hält uns wach, zwingt uns zum Handeln und verhindert, dass Freiheit zur Erstarrung wird.
Wenn Erbe automatisch an den Staat fällt und nicht mehr eigenbestimmt an Angehörige weitergegeben werden kann, hat das tiefe Auswirkungen auf die menschliche Psyche und Familienkultur. Die Möglichkeit, im Tod für die eigenen Lieben vorzusorgen, ist eines der ältesten und zentralsten Prinzipien des Menschseins – sie verbindet Generationen, ermöglicht Fürsorge über das eigene Leben hinaus und schafft ein Gefühl von Verantwortung wie Zusammenhalt.
Fällt diese Perspektive weg, entsteht ein Bruch: Individuen verlieren einen wesentlichen Teil ihrer Gestaltungshoheit und emotionalen Bindung über den Tod hinaus. Der Anreiz, zu sparen, zu arbeiten und Vermögen zu bilden, verändert sich – nicht mehr als Vorsorge für die Familie, sondern bestenfalls als Zweck für anonyme Gesellschaft oder Staatsinteressen. Menschen könnten sich entfremdet fühlen, da die eigene Lebensleistung nicht über die Generationen weitergegeben werden darf. Es entfällt die Möglichkeit, Werte, Schutz oder familiäre Würde zu sichern. Die Konsequenz: ein tiefer Eingriff in das Freiheitsgefühl, das Selbstverständnis und die Generationenbeziehungen innerhalb der Gesellschaft
Wer über den intellektuellen Tiefgang und die Analysefährigkeit der Autorin einen raschen Überblick gewinnen will, dem sei das ZDF Gespräch mit Precht empfohlen. Dieses Thema wird von der SPD und Linken, auch Grünen aktuell aus der Tiefe des Raums geholt, für mich ein letzter Bereich sozialistischer Anklagen, mit dem man auch nichts mehr gewinnen kann. Gerne aber steigen die Öffentlich Rechtlichen und Medien darauf ein, die Themen beackern, die im weitesten Sinne dem Gerechtigkeits-Feld angehören.