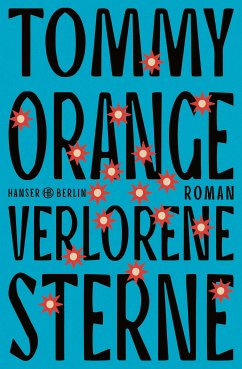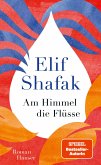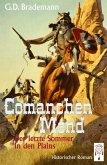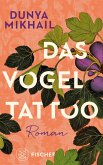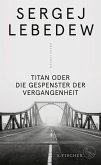»Verlorene Sterne ist die Art von Buch, die Leben rettet.« Kaveh Akbar DER Roman zum US-Wahljahr 2024: Ein spektakuläres Familienepos und eine vernichtende Anklage gegen Amerika von Tommy Orange Orvil Red Feather kommt nicht los von den Schmerzmitteln. Er weiß, er ist ein Klischee: verletzt ins Krankenhaus rein, geheilt und abhängig wieder raus - eine zeitgenössische Tragödie. Doch die Sucht zieht sich schon lange durch seine Familie. 1864 kämpft Jude Star, ein Vorfahre Orvils, als Kind gegen die brutale Austreibung seiner indigenen Sprache und Kultur. Am Ende ist es der Alkohol, der ihn kurzzeitig in seiner Trauer auffängt und schließlich niederstreckt. Meisterhaft verknüpft Tommy Orange die Schicksale zweier Jungen, zwischen denen 150 Jahre Kolonialgeschichte liegen, und zeigt uns Amerika in neuem Licht: als ein Kontinuum von Vertreibung und Gewalt, das nur hin und wieder von lichten Momenten des Widerstands unterbrochen wird.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D, L ausgeliefert werden.
"Aus vielen Mündern und Blickwinkeln erzählt sich die Historie der Natives; sichtbar wird eine Geschichte der Einsamkeit, der Verlorenheit, des Scheiterns, der Sucht und Abhängigkeit, aber auch der Kampf um das Leben und der Wunsch nach Zugehörigkeit - und am Ende gibt es doch Hoffnung auf Zukunft und Miteinander." Brigitte Schweins-Harrant, Die Furche 27.2.25 "Cooler ist dieser pathosgefährdete Stoff noch nie erzählt worden. Der Autor vermeidet alle Klagerhetorik, sondern behandelt die historische Katastrophe mit grimmigem Sarkasmus." Sigrid Löffler, Deutschlandfunk, 01.10.24 "Zugleich gelingt Orange... eine soghafte Erzählung. ... Darüber hinaus ist Verlorene Sterne sehr anspielungsreich, die Harlem Renaissance wird genauso zitiert wie zeitgenössische Popkultur oder indigene Kulturpraktiken." Jens Uthoff, die tageszeitung, 7.11.24 "Ein notwendiges Buch, nach dem man das 'Land der Freiheit' mit anderen Augen sieht." Thomas Correll, Nürnberger Nachrichten, 5.11.24 "Erschütternd! ... Ein düsteres Buch, teilweise auch ein wütendes Buch, aber auch ein wichtiges Buch mit wunderschönen Sätzen." Jan Ehlert, NDR-Podcast, eat.READ.sleep, 31.1.25 "Dies ist kein Roman, der an Mitgefühl appelliert oder Wunden leckt, er strahlt nicht einmal eine besondere Wut au, er beharrt aber auf einem Vermächtnis." Judith von Sternburg, Frankfurter Rundschau, 16.09.24 "Orange erzählt meisterhaft von einem Krieg gegen das eigene Volk, der bis heute tiefe Wunden hinterlässt." Tina Schraml, Bücher-Magazin, 6/2024 "Orange hebt nicht den moralischen Zeigefinger, sondern erkundet mit Witz die Widersprüche seiner Charaktere. Für jeden einzelnen findet er eine eigene Sprache und eine eigene Erzählweise." Marie Schoeß, Deutschlandfunk Kultur, 19.08.24 "Ein Roman mit vielen historischen Ankern, ...es geht um Ausgrenzung, Diskriminierung, Rassismus und Fragen der Identität. ... Orange erzählt mit Humor, multiperspektivisch, intelligent und poetisch, es macht Spaß, diesen Roman zu lesen." Gerrit Bartels, rbb Radio 3, 22.08.24 "Ein Buch, das einen von der ersten Seite an in die Geschichte einsaugt und nicht mehr loslässt: aufrüttelnd, brillant, dicht. ... Die Übersetzung von Hannes Meyer ermöglicht wie schon im Vorgänger beim Lesen den Eindruck, es handle sich um die Originalfassung - der Text büßt im Deutschen in keinster Weise an Intensität ein." Maria Nowotnick, Galore, 22.08.24 "An solchen Stellen, die einem beim Lesen den Hals zuschnüren, ist man Tommy Orange dankbar, dass er nicht linear und chronologisch erzählt, sondern exemplarische Szenen und Lebensausschnitte zu einer vielstimmigen Symphonie 'gesampelt' hat. Nach der letzten Seite des Romans überwiegen jedoch weder Empörung, Mitleid, Trauer oder Wut, sondern Staunen über die Leidensfähigkeit, Wandelbarkeit und innere Stärke der Nachkommen der Ureinwohner Amerikas. Und natürlich über Tommy Orange' polyphonen Roman mit Schwindel erregenden menschlichen Untiefen, hoffnungsvollen Erlösungs- und Machtfantasien, sowie einem stillen, unzerstörbaren Humor." Andrej Gato, Literatur Review, 8.10.2024 "Falsche Propheten des amerikanischen Traums finden sich in Oranges Roman zuhauf ... Ein Epos über intergenrationales Trauma, über den Krieg Amerikas gegen seine indigene Bevölkerung und das Leben von Natives in den heutigen USA. Komplex komponiert, fesselnd und tiefgründig, ästhetisch anspruchsvoll, spannend und thematisch relevant." Meike Stein, SR2 Kulturradio, 19.08.24 "Die große Stärke des Romans: Orange zeigt, welche Traumata die Überlebenden mit sich tragen und wie sie sich in Form von Suchtproblemen in allen Generationen wiederfinden lassen, ... mit Empathie und den richtigen Worten für das Komplexe. Was er uns mitgibt, ist das Geschenk, zu verstehen. Denn in Oranges Büchern geht es um das Bestehen in einer Welt, in der man sich nicht auskennt, in der es keine einfachen und klaren Zuordnungen gibt, in der Fragen statt Antworten und Nuancen statt Deutlichkeit warten. ... Bei Orange vermischt sich alles: Kleine Beobachtungen und große Geschichten, wahre Begebenheiten und Figuren, die es sein könnten, relevante Themen, die nicht erst auf den zweiten Blick überraschen. Das sind sie, die verlorenen Sterne." Teresa Preis, Buchkultur, 23.08.24 "Das ist große Literatur! Orange ist kein Show-off, ... er findet für jede Geschichte sehr behutsam die passende Form und Perspektive, ... er gibt seinen Charakteren immer Würde und Hoffnung, ... schwach strahlend wie verlorene Sterne." Daniel Koch, Diffus, 17.08.24