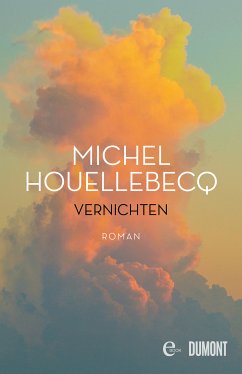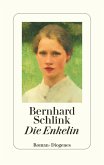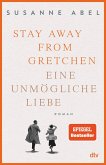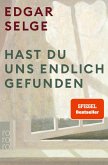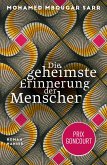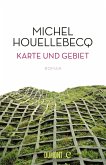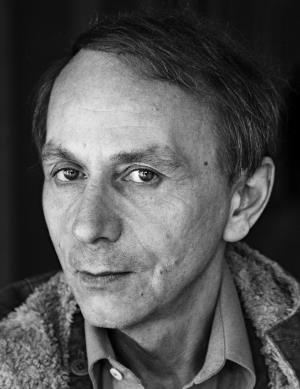Gewohntes vom Skandalautor
Michel Houellebecq ist wohl schon eine Marke. Kein anderer beschreibt den Sex so freizügig. Doch wer ihn nicht zum ersten Mal liest, wird sich fragen, was er Neues zu bieten hat.
Natürlich geht es auch um Politik und das Frankreich immer mehr im europäischen
Abendland verkommt. Doch bleibt dies ein Nebenschauplatz, auch wenn Hauptfigur Paul 2027 französischer…mehrGewohntes vom Skandalautor
Michel Houellebecq ist wohl schon eine Marke. Kein anderer beschreibt den Sex so freizügig. Doch wer ihn nicht zum ersten Mal liest, wird sich fragen, was er Neues zu bieten hat.
Natürlich geht es auch um Politik und das Frankreich immer mehr im europäischen Abendland verkommt. Doch bleibt dies ein Nebenschauplatz, auch wenn Hauptfigur Paul 2027 französischer Präsident werden will.
Das eigentliche Thema ist die Familie, der kranke Vater, der im Krankenhaus nicht von der Schwester gepflegt werden darf, weil sich die Gewerkschaft darüber beschwert. Das führt zu Lösungen, die ich nicht spoilern, will mit Folgen, die ich nicht verraten will. Am Ende landet selbst Paul im Krankenhaus, aber auch nicht verraten.
In den letzten Jahren habe ich alle Houellebecq-Bücher gelesen, im Sommer ist es auch ganz nett, doch diesmal fehlte es sehr an Handlung. Mehr als 3 Sterne wäre übertrieben.