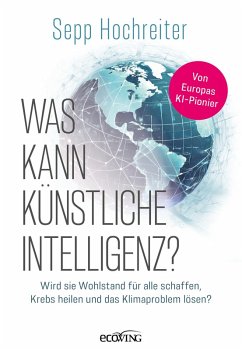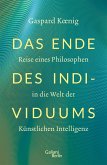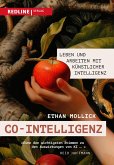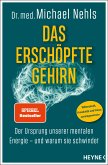Sepp Hochreiters Buch „Was kann künstliche Intelligenz?“ beleuchtet die Potentiale und Grenzen der KI-Technologie aus der Sicht eines führenden Experten. Er erklärt, wie KI bereits heute beeindruckende Texte, Bilder und Videos generiert und industrielle Prozesse revolutioniert, aber auch, wo ihre
Fähigkeiten überschätzt werden. Wenn ein Modell eine beeindruckende Antwort liefert, interpretieren…mehrSepp Hochreiters Buch „Was kann künstliche Intelligenz?“ beleuchtet die Potentiale und Grenzen der KI-Technologie aus der Sicht eines führenden Experten. Er erklärt, wie KI bereits heute beeindruckende Texte, Bilder und Videos generiert und industrielle Prozesse revolutioniert, aber auch, wo ihre Fähigkeiten überschätzt werden. Wenn ein Modell eine beeindruckende Antwort liefert, interpretieren wir oft Intelligenz oder Absicht hinein, wo lediglich gelernte Texte abgespult und mit statistischen Mustern und Wahrscheinlichkeiten kombiniert werden. Dies kann dazu führen, dass wir KI-Systemen Fähigkeiten zuschreiben, die sie nicht besitzen.
Der Universitätsprofessor Hochreiter, der mit der Entwicklung der LSTM-Technologie einen Grundstein für moderne Sprachverarbeitung legte, skizziert eine Zukunft, in der KI komplexe physikalische und biologische Prozesse simulieren kann. Dabei stellt er die Frage, ob KI tatsächlich globale Probleme wie den Klimawandel, tödliche Krankheiten und Pandemien lösen, komplexe wirtschaftliche und geopolitische Zusammenhänge besser als der Mensch verstehen kann oder ob sie lediglich eine gehypte Technologie bleibt.
Das Buch zeichnet die wechselvolle Geschichte der KI nach – von Durchbrüchen bis zu Durststrecken – und zeigt auf, wo Kontrolle notwendig ist. Hochreiter plädiert für eine realistische Einschätzung der KI und eine sinnvolle Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine. Sein Fazit: KI ist ein mächtiges Werkzeug, aber am Ende braucht es immer noch den Menschen, um die richtigen Entscheidungen zu treffen.
Der Autor widmet sich auch der spannenden Frage nach Europas Rolle im globalen KI-Wettlauf – und seine Einschätzung fällt ernüchternd aus: Der Kontinent liegt zurück. Zwar skizziert er konkrete Verbesserungsvorschläge, doch vor allem im Übergang von exzellenter Grundlagenforschung zur wirtschaftlichen Verwertung erkennt er eine gravierende Schwäche. Während Unternehmen wie Google oder OpenAI ihre Entwicklungen zügig in marktfähige Anwendungen überführen, mangelt es Europa an einer schlagkräftigen Infrastruktur, an großen Technologiekonzernen sowie an einer engen Verzahnung zwischen Forschung und Industrie. Ein zentrales Hindernis erkennt er auch in der praxisfernen Umsetzung des EU-„AI Acts“: Die bestehende Rechtsunsicherheit schrecke Entwickler davon ab, Projekte anzugehen oder Unternehmen zu gründen – aus Sorge, dass ihre Anwendungen womöglich nicht den regulatorischen Vorgaben entsprechen.
Mit seinem Buch gelingt es Sepp Hochreiter, die komplexe Welt der Künstlichen Intelligenz fundiert und zugleich leicht verständlich zu erklären – besonders im Kontext der großen Herausforderungen unserer Zeit. Beeindruckend ist dabei seine Fähigkeit, wissenschaftliche Substanz mit gesellschaftlicher Relevanz zu verknüpfen, ohne sich in theoretischen Abstraktionen zu verlieren: Sein klarer, sachlicher Stil schafft eine Sprache, die sowohl Einsteigern als auch versierten Lesern den Zugang zu einem der spannendsten Zukunftsthemen eröffnet.
Einen Kritikpunkt möchte ich jedoch anmerken, der mir im Buch zu kurz kommt: Mitunter erscheint mir die Darstellung der Risiken Künstlicher Intelligenz als zu nachsichtig. In einer Welt, in der Technologien immer häufiger gegen Menschen eingesetzt werden, bedarf es einer kritischeren Auseinandersetzung. Zwar zielt der EU-„AI Act“ darauf ab, diesen Gefahren durch Regulierung zu begegnen, doch es wird stets Entscheidungsträger geben, die sich wenig um die Einhaltung solcher Vorgaben scheren. Moralisch sind wir zwar Spitze, aber wir kommen faktisch nicht mehr vom Fleck, während sich die Welt rasant verändert.