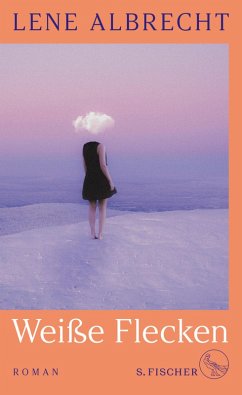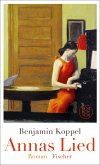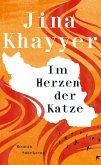»Seit meiner Ankunft wurde ich jeden Tag ein Stück 𝑤eißer« |41
Eine junge Deutsche reist nach Togo. Sie hat den Auftrag dort zu forschen, zu Fluchtgründen und Migration.
Anstatt auf Antworten zu den Anderen trifft sie auf Fragen, Irritationen und Spuren von Weißen, die sie stoßen auf sich
selbst und ihr eigenes Weißsein. Begegnungen mit Menschen, Gegenständen und Orten bilden sich in ihr zu…mehr»Seit meiner Ankunft wurde ich jeden Tag ein Stück 𝑤eißer« |41
Eine junge Deutsche reist nach Togo. Sie hat den Auftrag dort zu forschen, zu Fluchtgründen und Migration.
Anstatt auf Antworten zu den Anderen trifft sie auf Fragen, Irritationen und Spuren von Weißen, die sie stoßen auf sich selbst und ihr eigenes Weißsein. Begegnungen mit Menschen, Gegenständen und Orten bilden sich in ihr zu Geschichten, die trotz der Einordnungsversuche lose bleiben.
»Immer häufiger fragte ich mich, gab es ein richtiges, ein falsches Zuhören? Wie viele Arten des Zuhörens gab es? Und welche davon beherrschte ich? Manchmal erwischte ich mich dabei, bereits im Hören die Geschichte mit anderen Erzählungen abzugleichen. Wer erzählte sie mir und warum?« |71
Ihre Gedanken und Assoziationen verschieben die Orientierung und Bezugspunkte. Da kommt ihr Onkel in Erinnerung, der in Nigeria arbeitete und rassistische Bilder evoziert, das Kreisen ihrer Freundin um die Leerstelle ihres Vaters, der nach Kanada ging "weil die Scheißglatzen ihn so verprügelt haben, dass er im Krankenhaus lag" (|129) schiebt sich ein. Ihre Gedanken drehen sich um eine neue Bekannte, deren Vater aus Ghana ist, die Mutter aus den Niederlanden, die in Europa Schwarz und in Westafrika Weiß gelesen wird, um das Verhalten eines Weißen Deutschen im Freiwilligendienst, um die Gespräche mit einer togolesischen Familie, die um ihrer Abschiebung zu entgehen, "freiwillig" nach Togo zurückkehrte, um den Bibliothekar, der stets auf Abstand zu Weißen bedacht ist, um die Afroamerikanischen Tourist:innen auf Spurensuche, um die Menschenschauen der Deutschen Vergangenheit, Antiquitätenhandel und um Schwarze Deutsche Biographien, die unvollständig überliefert wurden. Fast obsessiv drehen sich ihre Gedanken um die kolonialen Spuren in ihrer eigenen Familie, weniger um ihren Weißen Ururgroßvater, der als Kolonialist in Panama lebte, denn um ihre Urgroßmutter, sein Kind kolonialer Herkunft, Weiß und Schwarz gelesen, uneindeutig, die als Einzige mit ihm nach Hamburg kam und in Deutschland blieb.
Diese lückenhaften kolonialen Spuren, die Leerstellen und das Schweigen sucht die Figur zu füllen, zur gleichen Zeit weiß sie um die Grenzen ihrer Perspektive und sie hinterfragt ihre widerstreitenden Motive. Rachel Dolezal fällt ihr ein oder die in Deutschland verbreitete Phantasierung von jüdischen Wurzeln, welche sie der internationalen Vermischung und Verwebung aller Identitäten gegenüber stellt, die eindeutige Zugehörigkeiten verwischen.
.
»Weiße Flecken« ist ein suchender Text, der den Motiven der Erkundung einer Deutschen auf koloniale Spuren nachgeht, sich dabei immer wieder an Grenzen stößt. Auch wenn die Figur sich mehr dem zurücktreten und zuhören gewidmet hätte, kann Kohärenz im Kontext dieser Geschichte nicht entsteht. So springt »Weiße Flecken« in Zeiten, Orten und auch in den Perspektiven auf die Weiße Hauptfigur und schwankt zwischen phantasierten Zusammenhängen, losen Identifikationen und dem darauf stoßen, dass Leerstellen bleiben, auch wenn sie mit aller Kraft gefüllt werden wollen.
Romane, die sich mit dem Deutschen kolonialen Erbe auf persönlicher Ebene, den lückenhaften Informationen und dem eigenen Weißsein literarisch auseinandersetzen, sind noch rar. Auch das macht »Weiße Flecken« lesenswert.