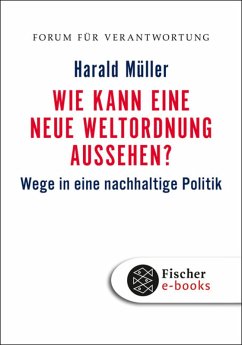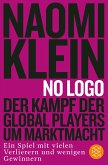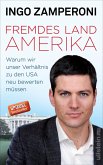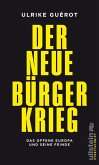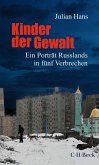Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, CY, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, IRL, I, L, M, NL, P, S, SLO, SK ausgeliefert werden.

Wie sich Harald Müller eine neue Weltordnung vorstellt
Was macht ein sehr gut bezahlter Spitzenmanager, wenn er sich mit beträchtlichem Vermögen frühzeitig aus dem Berufsleben zurückzieht, aber den "Ruhestand" nicht liebt? Der ehemalige Metro-Chef Klaus Wiegandt, Jahrgang 1939, hat im Februar 2000 eine Stiftung gegründet, die er als Vorstand steuert. Er hat sich (wie er im Vorwort zu dem vorliegenden Buch schreibt) "entschlossen", mit seiner Stiftung "gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen". Und er proklamiert: "Wir - die Zivilgesellschaften - müssen entscheiden, welche Zukunft wir wollen." Nachhaltigkeit und Zivilgesellschaft sind die beiden Codeworte. Wiegandt will die Zivilgesellschaften "mobilisieren" - mit Hilfe von Kolloquien und neuerdings mit dem "Großprojekt" einer zwölfbändigen Schriftenreihe, die er in Kooperation mit der ASKO Europa-Stiftung herausgibt.
Die Aufgabe, Wege der Nachhaltigkeit in der inter- und transnationalen Politik zu beschreiben, hat der Leiter der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung (HSFK) übernommen. Keine leichte Aufgabe, ist doch die internationale Politik laut Bismarck ein "fließendes Element". Indes, den Widerspruch zwischen internationaler Politik und Nachhaltigkeit versucht Harald Müller dadurch in schöner Dialektik zu überwinden, dass er Veränderung - auch die Veränderung der Regeln der Problemlösungen - zu einem Bedienungselement der Nachhaltigkeit macht. Grundsätzlich geht es ihm um die Frage, wie überhaupt die Voraussetzungen dafür geschaffen werden können, dass verlässliche Verhaltens- und Problemlösungsregeln zustande kommen.
Drei "Stolpersteine", die einem nachhaltigen Weltregieren entgegenstehen, müssten weggeräumt werden: Man müsse mit der Verschiedenheit in der Welt konstruktiv umgehen, einigermaßen vereinbare Vorstellungen von Gerechtigkeit verwirklichen und den großen Krieg verhindern. Diesen drei gravierenden Problemen sind die Hauptkapitel des Buches gewidmet. Anschließend werden die Steuerungsprobleme und Steuerungsmittel (Macht, Markt, Moral und Recht) sowie die diversen Akteure und Institutionen nachhaltigen Weltregierens behandelt. Am Schluss steht ein flammendes Plädoyer: "Keine Nachhaltigkeit ohne aktive Zivilgesellschaft!"
Die Lektüre vermittelt einen zwiespältigen Eindruck. Das liegt nicht zuletzt daran, dass Müller erklärtermaßen eine "Mixtur aus Realismus und Utopie" vornimmt. Dem Realismus folgt er, indem er die herrschende Lehre der "Global-Governance"-Literatur widerlegt, wonach der Staat seine Rolle als zentrales Subjekt des Regierens jenseits der Grenzen verliere. Er zeigt, dass die Staaten auch in der globalisierten Welt mit ihren vielfältigen Akteuren (die ausführlich behandelt werden) die ausschlaggebenden Faktoren sind und dass für ein wirksames Weltregieren die zentrale Stellung des Staates unverzichtbar bleibt; dass die Nichtregierungsorganisationen im Rahmen internationaler Organisationen der Regierungen zwar eine zunehmende Rolle spielen, dies aber überwiegend als "Hilfstruppen" der Mitgliedstaaten und der ihnen dienenden Sekretariate tun. Dem Realismus entspricht auch die positive Bewertung des "Konzerts der Mächte"; dessen Prinzipien seien "auch heute nutzbringend anwendbar". Fürwahr, dies sind ganz neue Töne aus der Frankfurter HSFK. Müller vermeidet es lediglich, die Sache mit dem Begriff "Gleichgewicht" (balance of power) beim Namen zu nennen. Wie das klassische Konzertmodell durch Regionalorganisationen und Rüstungskontrollregime zu ergänzen ist, schließt die Überlegungen ab.
Der Realismus-Anteil des Buches ist also bemerkenswert. Der Utopie-Teil kommt freilich auch zur Geltung. In eklatantem Widerspruch zur realistischen Relativierung der Rolle der Nichtregierungsorganisationen und anderer nichtstaatlicher Akteure wird ausgerechnet die Rechtsdurchsetzung - also der kritische Punkt jeder Weltordnung - ihnen zugetraut und zugeschrieben. Müller fragt, wer eigentlich für die Geltung des Rechts sorgen solle, wenn "die muskelbepackten Rambos der Weltpolitik" (gemeint sind die Großmächte) sich querstellen. Und er antwortet: "So seltsam es klingen mag, die beste Chance liegt in der Zivilgesellschaft bei sozialen Bewegungen und bei Nichtregierungsorganisationen." Wenn sie sich zusammenschlössen, würden sie "eine immense Macht" zusammenbringen. Die Nichtregierungsorganisationen seien "die einzige Klasse von Akteuren", die auf die Entscheidungen auch mächtigster Akteure Einfluss nehmen könne, ohne zugleich das Gefüge der internationalen Beziehungen gefährlichsten Konflikten auszusetzen.
Das Hohelied auf die Zivilgesellschaften mündet zuletzt in die emphatische Aufforderung an jeden Einzelnen, sich gesellschaftlich und politisch zu engagieren: "Informieren Sie sich. Lesen Sie täglich eine gute Zeitung . . . Gehen Sie in die Politik. Treten Sie in eine Partei ein. Kämpfen Sie dort für den Gedanken der Nachhaltigkeit . . . Schreiben Sie Leserbriefe . . . Treten Sie dafür ein, dass Ihr Unternehmen eine gemeinnützige Stiftung einrichtet . . . Gehen Sie in eine Nichtregierungsorganisation. Organisieren Sie in Ihrer Kirchengemeinde eine Partnerschaft mit einer Moschee in Jordanien - oder in München oder Köln . . ." Et cetera, et cetera. Denn Weltpolitik fange bei uns an, nirgends sonst! Der geneigte Leser wird sich die Augen reiben. Wird ihm die zugemutete Anstrengung nicht wie eine Sisyphos-Arbeit vorkommen? Der Autor hat diese Reaktion antizipiert und erklärt, das Urteil der griechischen Götter hätte kollektiv konterkariert werden können: "Sisyphos war allein. Hätte er genug Freunde dabeigehabt - er hätte es geschafft." Da lachen doch die Götter Griechenlands.
WERNER LINK.
Harald Müller: Wie kann eine neue Weltordnung aussehen? Wege in eine nachhaltige Politik. Herausgegeben von Klaus Wiegandt. Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt 2008. 520 S., 9,95 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
© Perlentaucher Medien GmbH