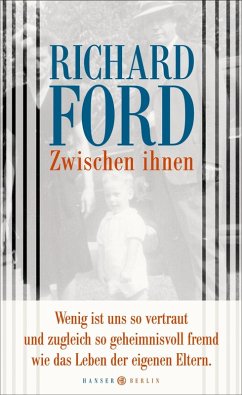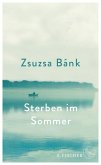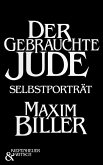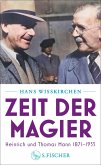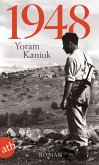Jedes Buch macht etwas mit dem Leser. Mich macht dieses Buch traurig, nicht weil es ein trauriges Buch ist, sondern weil ich mich frage, was von mir nach dem Tod bleibt.
Niemand wird über mich ein Buch schreiben, so wie es Richard Ford über seine Eltern geschrieben hat. Und ja, es sind eigentlich
zwei Geschichten, eine über seine Vater, eine über seine Mutter. Wiederholungen sind mir aufgefallen,…mehrJedes Buch macht etwas mit dem Leser. Mich macht dieses Buch traurig, nicht weil es ein trauriges Buch ist, sondern weil ich mich frage, was von mir nach dem Tod bleibt.
Niemand wird über mich ein Buch schreiben, so wie es Richard Ford über seine Eltern geschrieben hat. Und ja, es sind eigentlich zwei Geschichten, eine über seine Vater, eine über seine Mutter. Wiederholungen sind mir aufgefallen, Widersprüche nicht. Aber da der Autor sie im Nachwort begründet, kann ich deswegen keinen Stern abziehen.
Gut gefällt der Hinweis der SZ auf Tolstoi und sein Satz: „Alle glücklichen Familien sind einander ähnlich.“ Diese Familie ist glücklich und doch ist ein spannendes Buch entstanden. Nicht so lang wie Anna Karenina, aber das ist nur unser Glück. 140 Seiten, die ich schnell und gern gelesen habe.
5 Sterne.