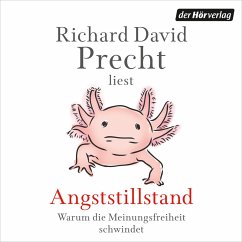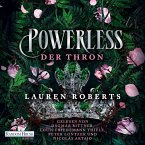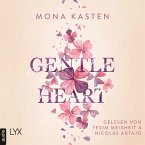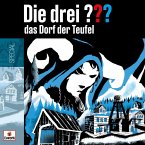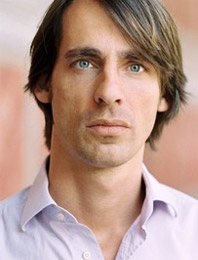Precht argumentiert auf zwei Säulen: Das egalste auf der Welt seien Hautfarben, denn seine Geschwister kämen aus Vietnam. Und der Kapitalismus durchdringe unser Leben auf das negativste in allen Verästelungen, jeder sei heute ein hypersensibles Marketingprodukt seiner selbst. Deswegen würde man
heute nichts mehr ertragen und Streit aus dem Weg gehen. Er selbst habe Roger Willemsen auf das…mehrPrecht argumentiert auf zwei Säulen: Das egalste auf der Welt seien Hautfarben, denn seine Geschwister kämen aus Vietnam. Und der Kapitalismus durchdringe unser Leben auf das negativste in allen Verästelungen, jeder sei heute ein hypersensibles Marketingprodukt seiner selbst. Deswegen würde man heute nichts mehr ertragen und Streit aus dem Weg gehen. Er selbst habe Roger Willemsen auf das heftigste bekämpft, weil dieser damals besser war als er selbst. Erst auf Augenhöhe habe er ihn akzeptiert.
Nun, was Precht hier beschreibt ist Wettbewerb und Kapitalismus pur. Er ist Teil dessen, aber immer noch mit einer unstillbaren Sehnsucht nach seiner eigenen, linken Sozialisation, die alle Unterschiede der Kulturen einebnen und für null und nichtig erklären wollte. Aus diesem Grund blendet Precht auch etwas aus, das ihm als negativ erklärt wurde: Religionen. Heute den Unterschied zwischen Judentum/Christentum und der dritten monotheistischen Religion nicht zu kennen, ist höchst gefährlich. Und aus diesem großen Elefanten speisen sich heute zu 90% alle Probleme. Man kann es lösen wie die SPD in Dänemark oder wie die deutsche Linke: durch völlige Negation.
Der Kapitalismus ist kein System, das dem Menschen äußerlich übergestülpt wurde, sondern die natürlichste Form menschlichen Zusammenlebens, sobald Freiheit und Verantwortung möglich sind. Er wurzelt in demselben Impuls, der die westliche Kultur antreibt: im Drang, zu schaffen, zu gestalten, zu verbessern. Wer arbeitet, tut das nicht nur, um zu überleben, sondern um sich selbst und die Welt zu formen. In dieser schöpferischen Bewegung liegt Freude – und diese Freude ist keine ideologische Täuschung, sondern eine der elementarsten menschlichen Erfahrungen.
Die alte Industriekritik sah im Kapitalismus eine Maschine der Entfremdung. In Wahrheit hat gerade die Marktwirtschaft die Arbeit aus der Erstarrung des Zwangs befreit. Sie erlaubt, was alle politischen Systeme vor ihr behinderten: dass der Einzelne selbst entscheidet, was er mit seinem Leben anfangen will. Ob jemand Autos zusammenschraubt oder sie entwirft, ob er Programme schreibt, Bücher verlegt oder Brot bäckt – immer gilt: In der freien Wirtschaft kann jeder, der will, sich einbringen, gestalten, sich selbst beweisen. Das ist keine Ideologie, sondern Anthropologie.
Hier berührt sich Ökonomie mit Psychologie. Maslow hat gezeigt, dass der Mensch nach Selbstverwirklichung strebt, sobald seine Grundbedürfnisse erfüllt sind. Diese Selbstverwirklichung ist kein Luxus, sondern Ausdruck des Lebenswillens. Wer etwas leistet, erfährt Sinn. Kapitalismus ist also nicht die ökonomische Pervertierung des Menschlichen, sondern seine Fortsetzung mit anderen Mitteln. Er schafft den Rahmen, in dem Leistung, Kreativität und Verantwortung sich entfalten können. Er ersetzt Zwang durch Möglichkeit.
Der von Reckwitz und Precht beklagte „kulturelle Kapitalismus“ ist in Wahrheit ein Missverständnis. Wenn Menschen sich heute selbst verwirklichen wollen, dann tun sie das nicht, weil sie vom Markt getrieben werden, sondern weil sie leben wollen. Der Kapitalismus instrumentalisiert nicht das Menschliche – er bietet ihm Raum. Was seine Kritiker als Selbstverwertung deuten, ist in Wirklichkeit Selbstgestaltung. Nicht jeder, der seine Talente einsetzt, „vermarktet“ sich. Viele schaffen, weil sie sich im Tun erkennen. Freude an Arbeit ist keine Anpassung, sondern ein Zeichen von Lebendigkeit. Wer unternehmerisch denkt, denkt nicht nur an Profit, sondern an Verbesserung. Er will etwas, das vorher nicht da war. So wird Wirtschaft zu einem fortgesetzten schöpferischen Prozess, zu einer alltäglichen Kunstform.
Der Kapitalismus in seiner besten Ausprägung ist also nichts anderes als die ökonomische Entsprechung der Aufklärung. Er setzt auf Vernunft, Eigeninitiative, Verantwortung und Vertrauen in die Fähigkeit des Menschen, selbst zu entscheiden. Er zwingt niemanden zu Gleichheit im Ergebnis, sondern eröffnet Freiheit im Versuch. Darin liegt seine Moral: nicht im Verteilen, sondern im Ermöglichen. Seine Würde liegt in der Anerkennung des Individuums als Quelle aller Wertschöpfung.
Natürlich braucht dieser Kapitalismus Maß, Recht, Kultur und Ethik. Aber er braucht keine Scham. Wer Produkte erfindet, Dienstleistungen anbietet, Risiken trägt oder Märkte schafft, ist kein Profiteur, sondern Träger des Fortschritts. Der Kapitalismus ist kein Fremdkörper im Menschlichen, sondern seine produktive Energie in organisierter Form. Er hat mehr Menschen aus Armut befreit, mehr Wissen erzeugt und mehr Kreativität freigesetzt als jedes andere System zuvor.
Der Mensch ist kein Opfer der Märkte. Er ist ihr Ursprung. Der Kapitalismus, richtig verstanden, ist nicht die Ökonomisierung des Lebens, sondern seine Entfesselung. Er verwandelt Bedürfnis in Handlung, Idee in Tat, Möglichkeit in Wirklichkeit. Darum ist er, bei aller Unvollkommenheit, die menschlichste aller Lebensformen: weil er den Menschen in seiner schöpferischen Freiheit ernst nimmt.