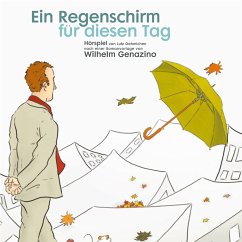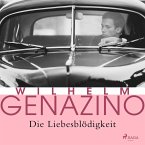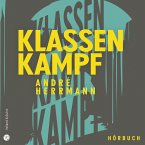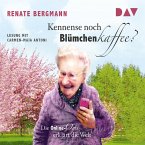Lebenssinn eines Überlebenskünstlers
Den FAZ-Statistiker von „Das Feld“ von Robert Seethaler wünschte ich mir. Auf 177 Seiten kommen so viele Menschen vor, dass ich sie nicht zählen konnte.
Einige nur für eine halbe Seite, andere wie der Engel (gibt es die weibliche Form „Engelin“?) Lisa, die
dem Ich-Erzähler ihr Konto als Abfindung überlässt, weil sie ihn verlassen hat, vergisst der…mehrLebenssinn eines Überlebenskünstlers
Den FAZ-Statistiker von „Das Feld“ von Robert Seethaler wünschte ich mir. Auf 177 Seiten kommen so viele Menschen vor, dass ich sie nicht zählen konnte.
Einige nur für eine halbe Seite, andere wie der Engel (gibt es die weibliche Form „Engelin“?) Lisa, die dem Ich-Erzähler ihr Konto als Abfindung überlässt, weil sie ihn verlassen hat, vergisst der Protagonist nie.
Wir wissen wenig über unseren Helden. Ort und Zeit der Handlung sind fiktiv.
Unser Protagonist spricht von „innerer Genehmigung“, die er braucht um sein Leben zu rechtfertigen. Ich nenne das Sinn. Diesen sieht er nicht in unbeachteten Berufen wie Sanitäter oder Wachmann.
Er läuft viel durch die Stadt, um sich zu erinnern, wie er z.B. Susanne als Kind ohne es zu merken an den Busen fasste, lehnt aber danach Kindheitserinnerungen ab. Ihm fällt eine alte „Sterbephantasie“ wieder ein: Er wünscht sich, „daß links und rechts meines Sterbebettes je eine halbnackte Frau sitzen sollte. Ihre Stühle sollten so nah an mein Sterbelager herangerückt sein, daß es mir leichtfiele, mit den Händen die entblößten Brüste der Frauen zu berühren. Ich glaubte damals, mit dieser körperlichen Besänftigung würde mir die Zumutung des Sterbens besser bekommen.“(S.24) Das glaube ich gerne. Es folgt eine Philosophie über Front- oder Seitenanblick von Brüste bis hin zum Satz, „daß sich Brüste immer weiter aus seinem Leben entfernen“(S.25).
Aber seine große Liebe hieß Lisa 42, die trotz obiger Handlung „mangelnde finanzielle Verwurzelung in der Welt“ bei ihm beklagte, woran die Beziehung wohl scheiterte. Mit Lisa braucht er keinen Sinn.
Lisa ist als Lehrerin gescheitert. Erst an dieser Stelle erfahren wir, dass unsere Hauptperson sein Geld als Schuhtester verdient, dessen Gehalt aber später so gekürzt wird, dass Leben so unmöglich ist, weshalb der Tester nur noch phantasierte Berichte abliefert.
Dann besucht er Margot, seine Friseuse und schläft mit ihr. Aber zum Orgasmus kommt er nicht. Er trifft Himmelsbach einen gescheiterten Fotograf, man könnte aber auch sagen ein Lebenskünstler wie er selbst. Himmelsbach wird später mit Margot verkehren. Er wird aber auch den Ich-Erzähler bitten bei Messerschmidt vom General-Anzeiger um einen Job für ihn zu bitten. Messerschmidt erklärt ihm wie schlecht Himmelsbach war, möchte aber, dass der Protagonist wieder für die Zeitung arbeitet, was er dann auch macht.
Susanne kehrt zurück in das Geschehen. Sie sagt, dass „armen Leute[n] in ihrem ganzen Leben keinen bedeutenden Menschen kennenlernen.“(S.71) und dass sie mit ihm über Unsinn reden kann. Erstmals fühlt der Lebenskünstler, dass Susanne ihn „nicht durchschnittlich findet.“ Später heißt es: „Es entsteht zwischen Susannes Beinen die Hoffnung, daß ich das Leben eines Tages werde genehmigen können“ (S.143)
Susanne lädt ihn auch zum Essen ein, wo er den anderen Gästen erzählt, er sei Leiter des Institut für Gedächtnis- und Erlebniskunst. Seine Aufgabe sei es, Menschen, denen das Leben wie ein langgezogener Regentag vorkäme einen Regenschirm für diesen Tag zu bieten. (S.105) Ein anderer Gast, Frau Balkhausen, nimmt das so ernst, dass sie sich mit dem Künstler trifft und 200 Mark dafür bezahlt. Auf ihre Empfehlung ruft auch noch Frau Tschakert ein, dass unsere Helden zu folgenden Ausruf bringt: „Stell dir vor, ich leite ein Institut, das es nicht gibt und verdiene damit sogar Geld“ (S.165).
Meine lange Inhaltsangabe ist nicht vollständig. Einige Personen musste ich weglassen, ebenso Gedanken über Essen, Langeweile oder Schuld. Das Buch kann man lesen als Biografie von Otto Normalverbraucher oder aber als philosophischen Beitrag zum Sinn des Lebens. 5 Sterne
(leicht gekürzt)