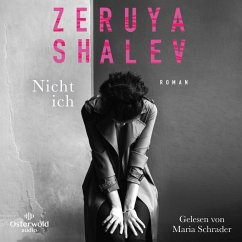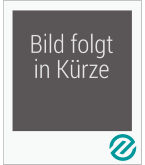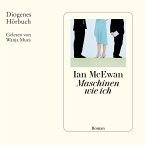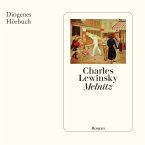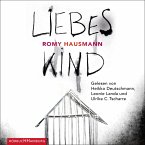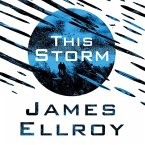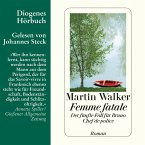»Am nächsten Tag lag ich mit geschlossenen Augen im Bett... Manchmal liege ich bis zum Abend so da, manchmal bis zum nächsten Morgen. Ich habe nicht die Kraft, die Augen aufzumachen.« |30
Mit geschlossen Augen verfängt sich eine Frau in Traumsequenzen, die den Wunsch umkreisen auszubrechen. Oder
ist sie schon gefallen? Befreit? Sie hat ihren Mann und ihre Tochter für eine neue Liebe verlassen.…mehr»Am nächsten Tag lag ich mit geschlossenen Augen im Bett... Manchmal liege ich bis zum Abend so da, manchmal bis zum nächsten Morgen. Ich habe nicht die Kraft, die Augen aufzumachen.« |30
Mit geschlossen Augen verfängt sich eine Frau in Traumsequenzen, die den Wunsch umkreisen auszubrechen. Oder ist sie schon gefallen? Befreit? Sie hat ihren Mann und ihre Tochter für eine neue Liebe verlassen. Oder ist die Tochter entführt? Eine Puppe? Hat sie eine neue Mama, selbst gewählt? Wartet die Tochter auf die Frau oder dreht sich »Nicht ich« um verschobene regressive Versorgungswünsche der Frau selbst? Liebhaber eins ist auch verlassen, nun gibt es einen neuen, ihre Haare fallen aus, sie pflanzt Teddybären, der Heiler verstummt nach seinem Rat, ihre Gebärmutter in den Exmann zu operieren, der wird vielleicht schwanger, auf jeden Fall dick, die Eltern versperren den Weg in die Regression, der Tod flirtet mit ihr, der Geheimdienst bleibt kühl und alles scheint darauf zu warten, dass die Figur wieder rund läuft oder reifen wird, zurück zur Tochter kehrt, ihre Haare und die Lächerlichkeit der Liebe erkennt.
Klingt schräg? Ist es. Vor dreißig Jahren debütierte die inzwischen etablierte israelische Autorin Shalev mit »Nicht ich«, einem assoziativen, Symbolgeladenen, strömenden Text, der im Titel auch mit den Worten Dazwischen, Flucht oder Übergänge hätte spielen können. Entgegen der konventionellen Form ihrer nachfolgenden Romane, steckt »Nicht ich« im Übergang von surrealer Lyrik in Prosa, flieht durch Gedankenstöme und Szenen und zerfällt immer wieder. Die brennende Intensität ihrer Figuren, die immer etwas an Anna Karenina erinnern, aber weder romantischem Kitsch noch Unterwerfung verfallen oder tragisch sterben, ist in »Nicht ich« pur, wenn auch fragmentiert. Die im Verlauf ihres Werkes immer expliziter ins Textbewusstsein drängenden Andeutungen auf eine permanente Bedrohung in Israel, bleibt im Debüt fast verborgen.
Träume und traumartig strömende Texte überwinden Zensur in Unschärfen. »Nicht ich« fließt durch sexuell explizite, komische, provokante Szenen, driftet in eine Biederkeit und unterwandert dann wieder gesellschaftliche Erwartungen und Regeln. Der dargebotene Bewusstseinsstrom bietet viel Stoff für psychoanalytisch und religionsgeschichtlich interessierte Leser:innen, auch liest sich »Nicht ich« anschlussfähig an aktuelle Diskurse zu Frauenbildern und Mutterschaft. Ist es nicht auch heute ein Tabubruch, dass einer Mutter der Kontakt zu ihrer Tochter abhanden kommt, dass sie ihren Mann betrügt, sich in Liebhaber stürzt, weitertreibt, ihre Eltern anklagt, und eins der Symbole der Weiblichkeit, ihre Haare, verliert?
.
Dennoch ist »Nicht Ich« ein unvollkommener Text, der trotz der erneuten Überarbeitung für die Neuerscheinung und Übersetzung unfertig erscheint. Er ist nur 200 Seiten lang, schafft es aber trotzdem, den Faden zu verlieren in seiner Mitte, um sich dann wieder zu fangen und den Bogen zu schließen. Dass er bei Ersterscheinung 1993 von der männlich dominierten Literaturkritik Israels gemischt aufgenommen wurde und bisher noch nicht ins Deutsche übertragen wurde, obwohl Shalev Bestsellerautorin ist, hat wahrscheinlich nicht nur mit der Form, der traumartig fragmentierten Erzählart und den provokanten Inhalten zu tun.
Doch gerade diese Unvollkommenheit verbunden mit bestechlicher Intensität und Humor macht »Nicht ich« lesenswert.