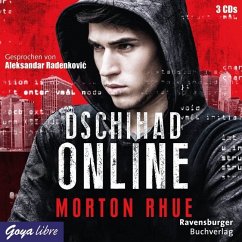Der 16-jährige Khalil und sein Bruder Amir leben in den USA. Khalil ist dort geboren und hat auch eine amerikanische Freundin. Amir, noch aus der bosnischen Heimat geflohen, fällt es dagegen schwer, in dem neuen Land heimisch zu werden. Er ist in die Fänge radikaler Islamisten geraten und versucht, auch Khalil mit Hilfe islamistischer Propagandavideos vom Dschihad zu überzeugen. Als Khalils bester Freund abgeschoben wird und seine Freundin ihn verlässt, wird er für die Parolen seines Bruders empfänglich. Doch als er merkt, in was er da hineingeraten ist, nimmt die Katastrophe schon ihren Lauf ... Das gleichnamige Buch, aus dem Englischen von Nicolai von Schweder-Schreiner, ist im Ravensburger Buchverlag erschienen.

Auch Kinder- und Jugendbücher beschäftigen sich mit Flucht, Krieg und Fremdsein. Das ist, Gott sei Dank, meistens viel besser als nur gut gemeint.
Von Anne Haeming
Zuerst ist da nur dieser alarmrote Ball. Er hüpft über die Grenze. Boing. Boing. Und auf einmal ist die ganze Menschenmenge, die hinter jener Grenze zusammengepfercht ist, still. Dabei ist es doch verboten, dieses Areal zu betreten. Der Leser blättert um. "Herr Aufpasser", fragt im nächsten Bild ein Junge im filzstiftgelben Pulli, "können wir . . . ?" Der Soldat im Tarnanzug, das Gewehr über der Schulter, er zögert. Und sagt dann, ein weiteres Mal Umblättern weiter: "Na gut, aber nur dieses eine Mal . . ." Natürlich hat sich in diesem Moment die Sache mit dem Eingesperrtsein erledigt. Ein für alle Mal. Die Menge strömt.
Die Grenze, wie Isabel Minhós Martins und Bernardo P. Carvalho sie in ihrem Bilderbuch "Hier kommt keiner durch!" zeigen, ist unsichtbar. Wirksam wird sie erst, indem sich die Masse an Filzstiftfiguren, mit grünen, gelben, rosa Gesichtern, lilafarbenen und blauen Nasen, Trainingsshirts, Anzügen, Gitarren und Bärten, an sie hält. Alle Figuren bleiben zunächst auf der linken Seite des Buches. Rechts: eine weiße Seite, abgegrenzt durch den Falz in der Buchmitte. Hier wird das Genre Wimmelbuch umfunktioniert, um zu illustrieren, was passiert, wenn Menschenmengen auf willkürlich scheinende Herrschaftsgesten stoßen. So zeigt der Band die Unbarmherzigkeit einer staatlich gezogenen Grenzlinie, ohne sie zu benennen, geschweige denn zu zeichnen. Sie ist ja schon da, mitten im Buch. Doch die Menge lässt sie verschwinden, stürmt sie in einer sanften Revolution. In dem bunten Mix an Figuren scheint alles auf, von der deutschen Botschaft in Prag 1989 bis zu Flüchtlingscamps in Mazedonien. Und somit die Allgemeingültigkeit des Horrors, nicht frei zu sein.
Wer in den vergangenen anderthalb Jahren versucht haben sollte, seine Kinder fernzuhalten von Zeitungstitelseiten, auf denen von Bombenstaub überzogene Jungs zu sehen sind, von Fernsehnachrichten, in denen Familien getreten werden, oder einfach nur von Infoschnipseln aus dem Internet mit Menschen auf der Flucht, Menschen in Angst, Menschen mit Waffen, der muss zwangsläufig gescheitert sein. Die Debatten um Flüchtlinge, sie sind auch Teil des Alltags von Kindern geworden. Genauso wie die Attentate in Paris, in Brüssel, in Bayern und die brennenden Flüchtlingsunterkünfte in der Republik. Dazu der vage Eindruck, dass das eine mit dem anderen zusammenhängt.
In einer Situation, die so komplex ist, dass selbst Politiker bisweilen den Überblick verlieren - wie soll man die Lage jenen erklären, die die Zeitung noch nicht oder gerade mal so allein lesen können? Wie viel Kontext und Mitgefühl Kinder- und Jugendbücher vermitteln können, beweisen die Regalmeter über die Zeit des Nationalsozialismus. Ganze Generationen wuchsen etwa mit Lisa Tetzners "Die Kinder aus Nr. 67"-Reihe, Judith Kerrs "Als Hitler das rosa Kaninchen stahl" oder den Werken von Klaus Kordon auf. Jetzt scheint es, als ob es eine neue Welle von Büchern mit Haltung gibt. Mit Geschichten über Flucht, Krieg, Fremdsein, und zwar im Heute angesiedelt, nicht vor 70 Jahren.
Es gibt Autoren, die vor dem Hintergrund eigener Fluchterfahrung schreiben wie Julya Rabinowich in "Dazwischen Ich": eine Teenagerstory aus der Ich-Perspektive über das Mädchen Madina, das zwischen allem hängt - Kindund Erwachsensein, Heimat und Fremde, neuen Freunden und dem Gedanken an ihre Großmutter, die zurückgeblieben ist bei den Soldaten. Andere, wie Kirsten Boie, haben sich von Flüchtlingen ihr Schicksal erzählen lassen und erzählen es nun weiter; zusammen mit Illustrator Jan Birck berichtet Boie in "Bestimmt wird alles wieder gut" für Kinder ab 6 Jahren vom Alltag in einer zerbombten Stadt wie Homs, von der Flucht, der Erstunterkunft - und zugleich von Lieblingspuppen und Hassan, der auf der Straße Fußball spielt: also allem, was Kinder hier eben auch so kennen. Am Ende des Spektrums stehen ganz philosophische Ansätze, die das Thema streifen, aber viel Empathie vermitteln, so wie Tomi Ungerers "Antworten auf Kinderfragen" in "Warum bin ich nicht Du?".
Doch natürlich gibt es, wie immer, wenn es um Komplexes geht, auch jene Bücher, die wohlmeinende Tanten einem zum Geburtstag schenken, um einem Bildungskram unterzujubeln. Und die man wegen ihres substantivlastigen Oberlehrertons doch nie liest. In diese Kategorie von "Gut gemeint" gehört etwa "Ein Blick in die deutsche Geschichte. Vom Ein- und Auswandern": Dort schreiben die Autoren Jochen Oltmer und Nikolaus Barbian etwa: "Gehen wir zurück bis zum Anfang der Neuzeit, und so geraten sogenannte ,Peuplierungsmaßnahmen', die Zuwanderung von Glaubensflüchtlingen und die Siedlungswanderungen nach Osten in den Blick." Oltmer ist Professor für historische Migrationsforschung, Barbian Geschichtslehrer - und so liest sich das Ganze auch. Ein paar Aha-Momente gibt's aber dann doch; das liegt am Charme der Zeichnungen von Illustratorin Christine Rösch. Etwa wenn auf einer Seite ein unförmiger Sack, ein Pappkoffer und zwei Plastiktüten mit arabischer Beschriftung zu sehen sind, darunter jeweils eine Zeile: "Gepäck eines Schwabenkindes", "Koffer eines italienischen ,Gastarbeiters'", "Gepäck eines syrischen Geflüchteten". Momente, in denen sich diese Fluchtgeschichten überlagern, haben wirklich das Potential, Klischees zu brechen.
Doch es ist der Kinderbuchautor Peter Härtling, mittlerweile 83, der mit "Djadi, Flüchtlingsjunge" über einen Elfjährigen, der als "UmF", als "Unbegleiteter minderjähriger Flüchtling", in einer WG als Pflegekind aufgenommen wird, den Kern trifft. Denn Härtling, der als Kind selbst mit Mutter, Tante, Schwestern die Flucht erlebte, er weiß, wie es sich anfühlt, dieses Fremdsein. Und wie das Böse in eine Kinderwelt einbricht. Als er die Bilder des toten Aylan Kurdi am Strand in der Türkei sah, habe er gewusst, er müsse darüber schreiben: "Mir wurde klar, dass es sinnvoll ist, vorzuführen, wie traumatisiert und verschlossen Flüchtlingskinder sein können - und wie Erwachsene damit umgehen könnten", sagt er. Sobald man die eigene Wunde zeige, würden Kinder zutraulich, gäben etwas von sich preis, sie merkten: "Da ist einer, der weiß was."
Isabel Minhós Martins, Bernardo P. Carvalho, "Hier kommt keiner durch!", Klett 2016, 40 Seiten, 13,95 Euro (ab 4); Julya Rabinowich, "Dazwischen Ich", Hanser 2016, 256 Seiten, 15 Euro (ab 14); Kirsten Boie, Jan Birck, "Bestimmt wird alles wieder gut", Klett 2016, 48 Seiten, 9,95 Euro (ab 6); Tomi Ungerer, "Warum bin ich nicht Du? Antworten auf philosophische Fragen von Kindern", Diogenes 2016, 192 Seiten, 20 Euro (ab 8); Jochen Oltmer, Nikolaus Barbian, Christine Rösch, "Ein Blick in die deutsche Geschichte. Vom Ein- und Auswandern", Jacoby & Stuart 2016, 128 Seiten, 19,95 Euro (ab 12).
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main