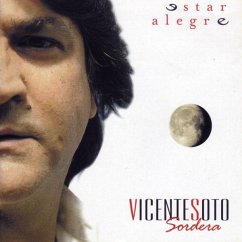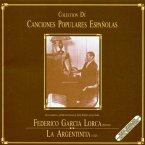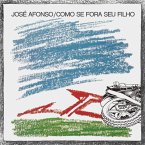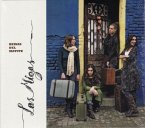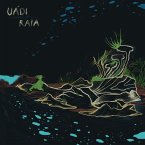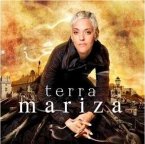Produktdetails
- Anzahl: 1 Audio CD
- Erscheinungstermin: 16. Dezember 2004
- Hersteller: Galileo Music Communication Gm / Galileo Music,
- EAN: 4250095800092
- Artikelnr.: 20156078
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
- Herstellerkennzeichnung
- Galileo Music Communication GmbH
- Dachauer Str. 5-7
- 82256 Fürstenfeldbruck
| CD | |||
| 1 | Sale la Luna (Bulerias) | 00:04:14 | |
| 2 | A mi bola (Tangos) | 00:03:27 | |
| 3 | La Plazuela (Bulerias) | 00:04:38 | |
| 4 | No te lo vendo (Tangos) | 00:03:18 | |
| 5 | Pa vestir santos (Alegrias) | 00:03:34 | |
| 6 | A Extremadura (Tangos) | 00:04:03 | |
| 7 | Que bonita eres (Tangos) | 00:03:34 | |
| 8 | Salistre (Bulerias) | 00:04:04 | |
| 9 | Pani (Tangos) | 00:04:05 | |
| 10 | La sangre mia (Bulerias) | 00:03:01 | |