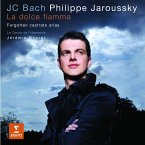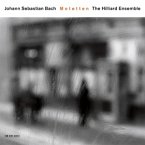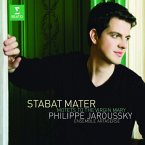Produktdetails
- Anzahl: 7 Audio CDs
- Erscheinungstermin: 21. Februar 2003
- Hersteller: EMI Music Germany GmbH & Co KG / EMI Classics,
- EAN: 0724356218826
- Artikelnr.: 20062017
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
- Herstellerkennzeichnung Die Herstellerinformationen sind derzeit nicht verfügbar.
| CD 1 | |||
| 1 | Italienisches Liederbuch / Mörike-Lieder | ||
| CD 2 | |||
| 1 | Mörike-Lieder | ||
| CD 3 | |||
| 1 | Mörike-Lieder / Eichendorff-Lieder / Goethe-Lieder | ||
| CD 4 | |||
| 1 | Goethe-Lieder | ||
| CD 5 | |||
| 1 | Goethe-Lieder / Spanisches Liederbuch / ..... | ||
| CD 6 | |||
| 1 | Lieder Nach Verschiedenen Dichtern | ||
| CD 7 | |||
| 1 | Mörike-Lieder | ||

Vor hundert Jahren starb Hugo Wolf: Fast alle hatten ihre Schwierigkeiten mit dem zerrissenen Komponisten, auch sein großer Interpret Dietrich Fischer-Dieskau
Man mache sich nichts vor: Der Traum von der Walhalla ist trügerisch. Ob Olymp oder Pantheon, die Götter sind, spätestens seit Offenbach, keineswegs mehr über alle Zweifel erhaben. Und die Vorstellung, eine Gipsbüsten-Armee großer Geister in einem Tempel über der Donau sage etwas aus über den wahren Rang von Künstlern, ist ein allenfalls holder Wahn.
Im Gegenteil: Beim Gespräch mit wirklich Musikinteressierten und -verständigen läßt sich, häufiger als manchen lieb, feststellen, wie wenig einhellig die Meinung selbst über die angeblich Allergrößten ist. Da bekennen kompetente Musiker, Bachs Fugen, Mozart, späten Beethoven, Schuberts Klaviermusik, Brahms' Lieder oder Rossini nicht zu mögen. Chopin-Fans lehnen Liszt ab und umgekehrt, ebenso geht es bei Debussy und Ravel. Perplex stellt man fest, wie erratisch musikalische Vorlieben wie Abneigungen sind. Solange die (Vor-)Urteile subjektiv aufrichtig motiviert sind, bedeuten sie mehr als wohlfeilen Kotau vor den "Meistern". In einem Fall allerdings scheint Einigkeit zu herrschen: Wer ein Faible für das Klavierlied hat, wird sich schwerlich von Schubert distanzieren. Doch schon danach setzen die Diskrepanzen ein: Schumanns "Frauenliebe und -leben" lieben nicht alle, des Textes wegen, Brahms-Autoritäten wie Klemperer und Brendel fanden es nicht unbedingt nötig, sich den Liedern zu widmen.
Vollends Hugo Wolf erfuhr eine zerrissene Rezeption, polarisiert zwischen hymnischer Stilisierung zum "letzten" großen Lied-Komponisten und scharf abkanzelnder Polemik. Exemplarisch, in mancher Hinsicht einzigartig ist, wie sich bei ihm historische Konfliktlinien verlängern. Hatte schon Schönberg auf die vor 1900 obligate Frage, ob er Wagnerianer oder Brahmsianer sei, selbstsicher mit "Selberaner" reagiert, so ist der Streit zwischen den "Neudeutschen" und den romantischen Klassizisten schon lange Historie. Man mag Brahms oder Bruckner bevorzugen, eine krasse Alternative ist dies nicht mehr. Doch in den divergierenden Einschätzungen Hugo Wolfs zitterte die alte Unversöhnlichkeit nach. Daß Brahms Wolf kaum mochte, rührte von dessen rabiaten Kritiker-Attacken her. ("Die Kunst, ohne Einfälle zu komponieren, hat entschieden in Brahms ihren würdigsten Vertreter gefunden.") Aber auch Strauss ("purer Dilettant"), Pfitzner ("Mache"), Klemperer und George Szell, auch Brendel äußerten sich abschätzig. Adornos Verdikt ("gespensterhafte Photographien dessen, was sogleich vergeht und nicht gehalten werden soll") wie auch das Hanns Eislers ("Mit ihm fängt die Zersetzung der bürgerlichen Lyrik an, die in der Folge immer krasser wurde und schließlich zu dem Typ des Kunstlieds von heute führt: komplizierte Begleitung und deklamierende Gesangsstimme, die im Vergleich zum Begleitpart sehr dürftig und kunstlos ist") lassen in ihrer Idiosynkrasie auch auf das schließen, was die Psychoanalyse "Abwehr" nennt. Denn daß Komponisten und Musikkenner solchen Rangs die eminenten Qualitäten Wolfs grundsätzlich nicht erkannt haben sollten, mutet unwahrscheinlich an: Wolfs spezifisches Komponieren muß Aversionen, ja Aggressionen erweckt haben, die offenkundig mit des Komponisten paranoidem Charakter zu tun haben, doch längst sich völlig von ihm gelöst haben. Wolf, dessen hundertster Todestag sich heute jährt, erscheint demnach als eine Art kompositorischer Katalysator, der Meinungen scheidet, offenkundig nicht kaltläßt: Ausgerechnet ihn als "Klassiker" zu feiern mutet untriftig an und tut ihm nachträglich den Tort bloßer Wohltemperiertheit an. Solcherart Gerechtigkeit in kleiner Münze hat er nicht verdient. Wohl aber, daß man sich auch seinen Wechselbädern aussetzt, die einen hin und her schütteln zwischen Zustimmung zu den Kritikern und gebannter Faszination.
Zunächst ist manchen Anklägern zu widersprechen. Selbst Adorno räumte ein, analog übrigens Dietrich Fischer-Dieskau in seinem neuen Hugo-Wolf-Buch, daß Wolfs "Dilettantismus" ihn zwar an größeren Formen hinderte, dafür vor Akademismus und Routine bewahrte: Phasen, in denen ihm nichts "einfiel", konnte und wollte er nicht durch Gewerkel überspielen. Außerdem gilt für seine Lieder das gleiche wie für Schumanns, Bruckners oder Mussorgskis Orchestersatz: Für seine Intentionen fand er die genau gemäßen Lösungen: kaum ein Lied, das nicht perfekt seinem Ansatz entspricht. Und stolz immerhin hat Wolf darauf beharrt, jede noch so skurrile harmonische Wendung in Mörikes "Zur Warnung" minutiös im Sinne der tradierten Harmonielehre begründen zu können.
Es war wohl wahr: Wolf konnte nur inspiriert komponieren oder gar nicht, was den Kult des "Einfalls" hochtrieb. Pfitzner, ewig gegen alle giftend, hat ihn zum Kern reaktionärer Ideologie gemacht. Doch gerade Wolfs Eichendorff-Lied "Nachtzauber" ist ein Traumstück integraler Text-Gesang-Klavier-Inspiration. Adorno, Wolf gegenüber immerhin ambivalent, hat, wenn auch polemisch, zu Recht auf den Zug zur quasiimpressionistischen Momentaufnahme hingewiesen, den er gleichwohl in anderen Zusammenhängen bewunderte.
In seinen besten Liedern, gewiß nicht wenigen, sind Wolf jäh improvisatorische, zugleich in sich unerhört konsistente Gestalten gelungen. "Arbeit" (Hauptvorwurf gegen Brahms) ist da kaum zu spüren, doch alles ist unverrückbar stringent gefügt. Nicht an Schumanns oder Liszts, erst recht nicht Brahms' Klaviermusik denkt man, eher an die Expansions-Kürzel der Chopin-Préludes, auch manches bei Debussy oder Skrjabin. Daß Wolf so sehr der deutsch-österreichischen Tradition einbeschrieben wurde, ist trauriges Relikt chauvinistischer Vereinnahmung: Er hätte Besseres verdient. Chopin, Debussy, Skrjabin - ein Dreiklang, auf den insgeheim Eislers Abwehr zielte: Verselbständigung der koloristischen, harmonischen wie pianistischen Komponente. Daran ist sicher einiges wahr. Manche Wolfschen Klavierparts verströmen narkotischen Zauber, können süchtig machen, darin aber auch überreizen. Andererseits gibt es in der Liedpianistik kaum Lakonischeres als Mörikes "Verlassenes Mägdlein". Gerade Wolf war, wenn nötig, der Kargheit fähig, ähnlich wie sein Bruder im "dilettantischen" Geist, Mussorgski.
Die Dissoziation von immer elaborierterem Klavierpart und mitunter eher deklamatorisch "ausdeutender" Gesangsstimme läuft potentiell, so hat es Eisler angedeutet, fast aufs Melodram hinaus. Selbst der Wolf-Prophet Fischer-Dieskau leugnet nicht diese Gefahr. Trotzdem ist der Einwand stark übertrieben: Fast immer bilden Text, vokales Melos und Instrumentalpart eine sinnfällige, oft genug berückende Einheit, und Wolfs harmonische Expeditionen führen die Gedichte oft kühn über die Grenzen bloß lyrischer Behaglichkeit hinweg. In der Bevorzugung übermäßiger Akkorde spürt man Wagnersche und Lisztsche Vorbilder; doch die frei einsetzenden Dissonanzen in "Herr, was trägt der Boden hier" ("Spanisches Liederbuch") verraten, wie sehr Wolf sich immer wieder den Grenzen des latent atonalen Fruchtlandes näherte. Was für und gegen Wolf spricht, läßt sich nun, durchaus suggestiv, einer Kassette der Firma EMI-Electrola mit wiederveröffentlichten Aufnahmen Fischer-Dieskaus und Gerald Moores vorwiegend aus den fünfziger Jahre entnehmen, die auch ein Album mit neueren Aufnahmen von Wolfs Orchesterwerken, darunter die "Penthesilea" unter der Leitung des Dirigenten Fischer-Dieskau, enthält.
Auf eine lapidare Formel gebracht: Wo Wolf groß ist, ist auch sein Interpret groß. Die Grenzen einiger Werke werden auch zu denen des Sängers. Wahrscheinlich sind die Mörike-Lieder letztlich Wolfs Bestes in der seismographischen Einfühlung in die Gedichte, der spontanen Eingebung, der oft mirakulös geglückten Balance semantisch-expressiver und koloristischer Momente. Alles, was nach innen geht, gelingt dem noch jugendlichen lyrischen Bariton geradezu betörend: geschmeidiges Ebenmaß der Stimme, Legato, kontrollierte Messa di voce, Textverständlichkeit bis in jede Silbe - manche Aufnahmen schlagen einfach in ihren Bann. Hinzu kommt Moores unerhört souveränes Klavierspiel, nicht immer modern-analytisch distinkt, in wenigen Turbulenzen leicht vorsichtig, doch stets signifikant als Evokation des Ganzen. Auch in den anderen Lied-Sammlungen gibt es schlechthin Modell-Versionen. Doch da, wo Wolf glaubt, sich "kernig" geben zu sollen, etwa in einigen Eichendorff-Liedern, ganz im Gegensatz zu Schumanns unvergleichlichem "Liederkreis", da glaubte auch Fischer-Dieskau auftrumpfen zu müssen. An zwei Vertonungen desselben Worts läßt sich dies belegen: Schumanns "Im Walde" schließt mit dem beklommen pianissimo absinkenden "und mich schauert's im Herzensgrunde". Wolfs "Heimweh" endet mit dem plakativen "grüss dich, Deutschland, aus Herzensgrund" als pompöser Apotheose, die das bis dahin so bewegende Lied konterkariert. Brendel hat Hermann Prey einmal animiert, "Deutschland" durch "Sara" zu ersetzen, was dieser sich doch nicht traute. Fast immer, wenn ein Lied sich ins Heroisch-Affirmative wendet, klingt schon beim jüngeren Fischer-Dieskau ein manieriert hoch-hohler Ton an. Eigentlich paßt er nicht zu Wolf, entspricht bisweilen manch herrischem "Zarathustra"-Gestus des ebenso gefährdeten Nietzsche: die Zarten als die Möchtegern-Kraftkerle.
GERHARD R. KOCH
Hugo Wolf: Lieder und Orchesterwerke. Dietrich Fischer-Dieskau, Gerald Moore, Radio-Sinfonieorchester Stuttgart. 7 CDs EMI 562189-195
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main