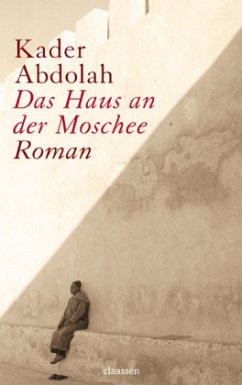Dieser fünfte Roman des exiliranischen Autors Kader Abdolah breitet das zutiefst menschliche Schicksal einer iranischen Großfamilie zur Zeit der Anti-Schah-Revolution vor uns aus. Die zunehmende Konfrontation zwischen radikalen und gemäßigten Strömungen im Islam zieht sich dabei wie ein dunkler Faden durch das bunt schillernde Geschichtengewebe.
Ein altes Haus in Senedjan. Es ist Teil der Moschee, und die Moschee ist Teil des Hauses, und so ist es immer gewesen. Oberhaupt der Gemeinschaft aus Frauen und Kindern, Kaufleuten und den aufeinander folgenden Imamen ist der wichtigste Mann des Basars, der Teppichhändler Aga Djan - seit 800 Jahren zählt seine Familie zu den einflussreichsten der Stadt. Aga Djan ist ein strenggläubiger Muslim, der liebevoll und fürsorglich über Haus und Moschee wacht. Unter seiner Obhut leben die Menschen in Senedjan in einträchtiger Harmonie. Bis die von Teheran und den Aufständen gegen das korrupte Regime des Schahs ausgehende Unruhe im Land auch sie erreicht. Im Hintergrund droht bereits der Krieg mit dem Irak, während Aga Djan hilflos mit ansehen muss, wie um ihn herum Familienmitglieder und Freunde ermordet, ins Exil gezwungen oder zu wütenden Fundamentalisten werden. Völlig verändert begegnen ihm alte Bekannte wieder und bestätigen am Ende, dass das Paradies, aber eben auch die Hölle immer die anderen sind.
Ein altes Haus in Senedjan. Es ist Teil der Moschee, und die Moschee ist Teil des Hauses, und so ist es immer gewesen. Oberhaupt der Gemeinschaft aus Frauen und Kindern, Kaufleuten und den aufeinander folgenden Imamen ist der wichtigste Mann des Basars, der Teppichhändler Aga Djan - seit 800 Jahren zählt seine Familie zu den einflussreichsten der Stadt. Aga Djan ist ein strenggläubiger Muslim, der liebevoll und fürsorglich über Haus und Moschee wacht. Unter seiner Obhut leben die Menschen in Senedjan in einträchtiger Harmonie. Bis die von Teheran und den Aufständen gegen das korrupte Regime des Schahs ausgehende Unruhe im Land auch sie erreicht. Im Hintergrund droht bereits der Krieg mit dem Irak, während Aga Djan hilflos mit ansehen muss, wie um ihn herum Familienmitglieder und Freunde ermordet, ins Exil gezwungen oder zu wütenden Fundamentalisten werden. Völlig verändert begegnen ihm alte Bekannte wieder und bestätigen am Ende, dass das Paradies, aber eben auch die Hölle immer die anderen sind.

Die Familiensaga des Iraners Kader Abdolah zeichnet ein farbiges Bild seiner Heimat, die er verlassen musste. Manchmal tut er dabei des Guten zu viel.
Alles beginnt mit dem Mann auf dem Mond. Schahbal, Spross einer einflussreichen und frommen Familie, die seit Jahrhunderten das Haus an der Moschee in einer nordiranischen Stadt bewohnt und Imam und Moazzen stellt, will unbedingt im Fernsehen live verfolgen, wie der kleine Schritt des Astronauten Armstrong zum gigantischen Sprung für die Menschheit wird. Doch weil die Mullahs aus Qom in Flimmerkisten Teufelszeug und in Amerikanern Gottlose sehen, muss der Fernsehabend mit den beiden Onkeln, dem Imam Alsaberi und Agha Djan, dem Patriarchen der Familie, eben heimlich stattfinden.
Für Letzteren, den Teppichhändler und Basarvorsteher, zieht mit den flimmernden Bildern auch eine Ahnung auf, dass neue Zeiten ins Haus stehen. Schon lässt der ungeliebte Modernisierungsdiktator aus Teheran durch seine europäisch gekleidete Frau nicht nur Krankenhäuser, sondern auch Kinos eröffnen, in denen allzu freizügige amerikanische Filme gezeigt werden, und provoziert prompt den bewaffneten Untergrund der erstarkenden Gotteskrieger. Die werden ein Jahrzehnt später Reza Pahlewi aus dem Land jagen und ihrerseits eine Diktatur errichten.
Die Mitglieder der Familie Agha Djans finden sich in den Auseinandersetzungen zwischen islamischen Fundamentalisten und ihren Gegnern auf Seiten der Opfer und Täter wieder oder geraten zwischen die Fronten. Gegenspieler in dieser politischen Familientragödie sind der junge Schahbal, der sich einer marxistischen Studentengruppe anschließt, die zuerst vom Geheimdienst des Schahs und später von den Mullahs geächtet wird, und der energische Geistliche Galgal, der als Schahgegner ins Exil flieht und Jahre später als Adlatus Chomeinis und grausamer Richter Gottes zurückkehrt, ein Jakobiner mit Bart und Turban, dessen revolutionärer Eifer die eigene Familie nicht schont.
Selbst Frauen verwandeln sich in hartherzige Wächterinnen über die Befolgung der Scharia, wie die Witwe des verstorbenen Imams und ihre verbitterte Tochter Sediq, die von Galgal verlassen wurde. Am Ende fällt der einzige Sohn des Patriarchen den machthungrigen Sittenwächtern zum Opfer. Verzweifelt fährt der Vater nachts mit dem Leichnam seines Kindes durch die nordiranischen Berge: Für den vermeintlich Gottlosen findet sich kein Grab.
Kader Abdolah, der 1988 aus Iran fliehen konnte, seitdem in den Niederlanden lebt und unter einem Pseudonym, das an zwei ermordete Freunde erinnert, auf Niederländisch schreibt, hat erneut eine Familiensaga verfasst, in deren Mittelpunkt eine starke Vaterfigur steht. Anders als in seinem großartigen Roman "Die geheime Schrift" über einen taubstummen Teppichflicker spielt sich die Tragödie über einen kürzeren Zeitraum ab - dafür weitet sich die Perspektive, indem Figuren des politischen Lebens wie Chomeini und dessen Ehefrau in die Handlung einbezogen sind. Beide entdecken in Abdolahs Roman mit Hilfe des Fotografen Nosrat, eines Bruders Agha Djans, das Medium des Films für ihre Zwecke: Chomeini, um sich unsterblich zu machen und die Massen zu agitieren, und seine Frau, um in einer engen Beziehung zu Nosrat, der den Alltag des Ehepaars filmt, einen Hauch jener Aufmerksamkeit zu erhaschen, die ihr als Gattin des Revolutionsführers stets verwehrt blieb. Chomeini hingegen zückt bei Dariush Mehrjuis Film "Die Kuh" das Taschentuch und verordnet der Nation einen Fernsehabend mit diesem Meisterwerk über eine ländliche Mensch-Tier-Tragödie. In derselben Nacht stürmen seine Getreuen die amerikanische Botschaft.
Trotz solcher Szenen hinterlässt die Lektüre bei aller orientalischen Opulenz und anrührenden Tragik einen etwas schalen Eindruck. Denn die politischen und psychologischen Handlungsmotive der Figuren bleiben nebulös. In einem Interview bekundete Abdolah unlängst, dieses Buch ausschließlich für seine westlichen Leser geschrieben zu haben - in Iran sei das alles bekannt. Uns aber wolle er an die Hand nehmen und einen Blick hinter den Vorhang gewähren. Und, so fügte er noch hinzu, er wisse genau, was wir wissen und was nicht. Die Literatur scheint somit nicht anders zu funktionieren als die Vermarktung iranischer Filme und Kunstinstallationen, die sich in solche teilen, die in Iran für das iranische Publikum gemacht werden und oft von Problemen erzählen, die es auch bei uns gibt, und solche, die eher den westlichen Zuschauer anvisieren, von dem man meint, dass er nach Exotik verlange: Bilder von trauriger Schönheit in prächtigen Farben und vom Schicksal gestauchte Gestalten in magischer Landschaft.
Was genau will uns der Autor, der um die Magie seiner Bilder weiß, zeigen? Das Iran der sechziger und siebziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts, so wie Abdolah es schildert, ist eine archaisch-orientalische Märchenwelt, die nicht ohne Zutun des Schahs in den Strudel politischer Machtkämpfe gerät, in Blut und Gewalt versinkt und sich schließlich in einen grimmigen Gottesstaat verwandelt, in dem der Koran missbraucht und pervertiert wird. Der Roman ist eine Elegie aus der Feder eines aus Land und Sprache Exilierten, getragen vom Heimweh nach einer Heimat, die es so nicht mehr gibt, erzählt in einem für Abdolah bisher eher untypischen, konventionellen Erzählstil. Fast ganz verschwunden sind die surrealen Bilder, die skurrilen Charaktere und die nicht immer einfach zu konsumierende Vermischung von verschiedenen Erzählebenen und Stimmen. Dafür breitet sich zwischen den Zeilen Orientalismus aus, ein Bild der islamischen Welt, wie es derzeit im Westen den Gesetzen von Angebot und Nachfrage zu folgen scheint und uns vor allem von Autoren, die hier und nicht dort leben, präsentiert wird: eine Mischung aus Tausendundeiner Nacht und religiösem Fanatismus, aus Gewalt, verschleierten Frauen und skrupellosen Mullahs, denen Schahbal, das Gewissen der Familie, bis nach Kabul folgen wird, um ihre Untaten zu rächen. Die Hoffnung nimmt er mit ins Exil, wo er zum literarischen Rapporteur des Geschehens wird.
An einem solchen Bild der jüngsten iranischen Geschichte ist sicher vieles richtig, es ist inzwischen auch nicht ganz unbekannt. Man sollte sich jedoch hüten, es als das einzig gültige zu lesen. Hinter dem Vorhang ist mehr, als Abdolah uns zeigen möchte.
SABINE BERKING.
Kader Abdolah: "Das Haus an der Moschee". Roman. Aus dem Niederländischen übersetzt von Christiane Kuby. Claassen Verlag, Berlin 2007. 400 S., geb., 19,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Sehr eingenommen zeigt sich Elisabeth Kiderlen von Kader Abdolahs Roman "Das Haus an der Moschee", der in Form einer Familiengeschichte von der explosiven Situation im Iran am Vorabend der islamischen Revolution 1979 erzählt. Sie attestiert dem im niederländischen Exil lebenden Autor, die Risse in der iranischen Gesellschaft eindringlich vor Augen zu führen, indem er die verschiedenen Strömungen der Zeit - Sozialisten, Vertreter des Islams als Lebensform, politisierte Islamisten, Liberale - auf dem Anwesen der Familie Farahani aufeinander prallen lässt. Abdolahs Buch ist für Kiderlen der "Roman seines Lebens", ein Werk, das in ihren Augen höchst gekonnt iranische Geschichte, autobiografische Erlebnisse und die Freiheit der Dichtung verknüpft.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH